Zeitzeugenberichte


 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Erzählte Geschichte (Oral History), die in Form von schriftlichen Notizen, Berichten, Tonband- und Videoaufzeichnungen festgehalten und ausgewertet wird, spielt in der Arbeit der Geschichtswerkstatt eine wichtige Rolle. Dabei geht es weniger um umfassende Faktensammlungen, als vielmehr um das persönliche Erleben, um die subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung erlebter und gelebter Stadtteilgeschichte. Erzählte Geschichte kann aber nicht nur neue Quellen erschließen, sondern auch zu einer Demokratisierung der Geschichtserkundung beitragen, indem sie die Erinnerungen und Geschichten der von geschichtlichen und aktuellen Entwicklungen betroffenen Menschen in den Mittelpunkt rückt.
Barmbeker erzählen
Mit dieser Seite bieten wir allen mit Barmbek verbundenen Menschen die Möglichkeit, ihre Barmbek-Geschichten, ihre Sicht des Stadtteils darzustellen. Das können kleine Schilderungen von alltäglichen oder besonderen Erlebnissen, Ereignissen oder Orten sein, Lebensgeschichten, Tagebuchnotizen, Gedichte oder andere literarische und künstlerische Ausdrucksformen.
Rufen Sie Ihre Erinnerungen wach, schreiben Sie auf, was Sie mit Barmbek verbindet, im positiven wie im negativen Sinne. Schicken Sie uns Ihre Geschichten, per Post oder per Mail:
Geschichtswerkstatt Barmbek
Wiesendamm 25
22305 Hamburg
info@geschichtswerkstatt-barmbek.de
Barmbeker Erinnerungen von Peter Kipp
Meine Familie stammt nicht ursprünglich aus Barmbek, trotzdem habe ich hier meine frühe Kindheit verlebt. Die Großeltern kamen aus Danzig, sie mussten wegen der politischen Verhältnisse „optieren“, weil mein Großvater Beamter bei der Reichsbahn war. Entweder: für Polen oder Deutschland. Aus diesem Grunde kam die Familie mit vier Kindern, über Cuxhaven nach Hamburg und fand dann, etwa 1933, in Barmbek, Brucknerstraße 19, ihre neue Heimat. Das war an der Kreuzung Sentastraße / Brucknerstraße. Obwohl ja nach dem Krieg quadratkilometerweise nur Ruinen und Trümmerwüste herrschten, waren an unserer Kreuzung von den vier Blocks noch drei relativ unbeschädigt vorhanden, sodass hier noch eine mehr oder weniger geordnete Wohnsituation, zwar mit Einquartierungen, bestand.
An einer Ecke befand sich die Bäckerei Ponsel, gegenüber das Milchgeschäft von Herta Ross, daneben der Kolonialwarenladen von den Schwestern Reetwisch. Etwas weiter, in einer Holzbude vor der Schule, der Fischhändler Kluziak. An der nächsten Straßenecke der Feinkostladen von Strahl und gegenüber der Gemüseladen von Martens. Etwas weiter noch der Tabak- und Zeitschriftenkiosk von Rittmeister, dazwischen der Kohlenhändler Hohnsbein mit seinem bissigen Köter „Troll“, der frei herumlief und uns Kindern höllische Angst machte. Also eine fast dörfliche Lebenssituation – jeder kannte quasi jeden.
Meine Mutter, die jüngste der vier Geschwister, war 1939 zwanzig Jahre alt und hütete die Kinder der Familie Steffen in der Sentastraße ein. Mit ihrer Erscheinung und den blonden Haaren hatte sie bei den täglichen Einkäufen, die Aufmerksamkeit von Bäckermeister Hans Ponsel, erregt. Was sich in kleinen Aufmerksamkeiten, „wie ein Stückchen Kuchen mehr“, ausdrückte. Der Funke ist aber leider nicht übergesprungen.
Der schneidige Luftwaffenoffizier, der seine Schwester in der Sentastraße häufig besuchte, hat mit seiner Uniform mehr Aufsehen erregt, sodass 1941 eine Verehelichung stattfand. (Er natürlich in Uniform) Den Kriegsverhältnissen geschuldet, sind die Jungvermählten anschließend nach Schlesien auf einen Luftwaffenstützpunkt umgesiedelt, wo ich dann 1944 geboren wurde. Nach turbulenter Flucht (teilweise im Bombenflugzeug) zurück Richtung Hamburg sind wir dann im Mai 1945 bei meiner Oma in der Brucknerstraße untergekommen. Da auch die übrigen Geschwister und Schwiegerkinder aus dem Krieg zurückströmten ist es bei „Mama“ in der Brucknerstraße eng geworden. So sind meine Eltern und ich gegenüber in der Sentastraße bei Familie Steffen auf Zimmer gezogen.
Bäckermeister Ponsel war nicht nachtragend, obwohl sein „Schwarm“ jetzt mit Mann und Kind wieder aufgetaucht war. Er selbst hatte auch geheiratet und bekam eine Tochter namens Christel. Der gleiche Vorname wie der meiner Mutter!? Trotzdem bekam ich die Gunst, wenn ich zum Brot- oder Brötchenholen rübergeschickt wurde, dass immer eine kleine, extragebackene Heißwecke für mich bereitlag, obwohl noch Lebensmittelmarken nötig waren. Hans Ponsel lugte dann aus seiner Backstube und lächelte mir zu.
Der zentrale Spiel-Treffpukt für uns Kinder war die große Sandkiste neben dem Fußballplatz vom FC Paloma. Sie war rundherum mit Gehwegplatten befestigt, zwei Schaukelgerüste und drei Sitzbänke waren vorhanden. Sie war groß genug, dass mindestens 10 Kinder gleichzeitig ungestört spielen konnten. Höhepunkt war, wenn man nicht zum Mittagessen nach Hause gerufen wurde, sondern die Mutter mit Kartoffelsalat und Ei zur Sandkiste kam und man konnte auf der Bank, ohne große Spielunterbrechung, das Essen einnehmen. Im Gegensatz zu anderen Kindern, hat meine Mutter das aber nur ganz, ganz selten getan.

Gasanstalt, links Problock, rechts Schleidenschule,
vorn Sportplatz FC Palom
Es war etwa 1948, da gab es eine Riesenenttäuschung: plötzlich war die Sandkiste leer! Während wir noch ratlos herumstanden, kam ein mächtiger englischer Militär-Lastwagen voll mit frischem, weißen, sauberen Spielsand und füllte die Kiste wieder auf. In wahrer Wonne stürzten wir uns in diesen Sand und merkten erst jetzt wie dreckig, unhygienisch und verschmutzt der alte Sand von all den verkohlten Brandresten und dem Trümmerstaub war.
Die andere wichtige Spielstätte war der Schleidenpark, heute Biedermanplatz, mit Planschbecken und Liegewiese. Auf den Gehwegen ließen sich wunderbar Wettfahrten mit unseren Rollern veranstalten. Der Park hatte sogar einen „Parkwächter“, der in einer kleinen Holzbude residierte. Er hatte alles im Blick und jeder Unfug am Planschbecken wurde streng mit „Parkverbot“ bestraft. Vandalismus oder Farbschmierereien, die gab es dank seiner Anwesenheit nicht.
Eine große Mutprobe gab es an der „kaputten Brücke“ der Straße Käthnerort über den Osterbekkanal. Die Brücke ist in den Bombennächten 1943 zerstört und die Straße unterbrochen worden. Unter der Brücke verlief ein dickes eisernes Rohr zur Gasversorgung der gegenüberliegenden Stadtteile. Die Brückentrümmer waren bereits abgeräumt worden, nur das restliche Gasrohr ragte noch aus dem Erdreich bis halb über den Osterbekkanal. Die Mutprobe bestand darin, sich rittlings auf das Rohr zu setzen und dann bis zum Ende vor zu robben. Man befand sich dann in drei Metern Höhe über der Kanalmitte. Jede leichte Körperbewegung brachte das Rohr aber in Schwingung, sodass am Rohrende eine erhebliche Auf-und-ab-Bewegung zu bestehen war. Das Ganze war natürlich strengstens verboten, von der Polizei und den Eltern sowieso.
Zum Thema Roller: mein Onkel Erich, auch in Barmbek wohnhaft, war damals einer der größten Fahrradgroßhändler in Hamburg. Da er aus dem Siegerland stammte, hatte er verschiedene Verbindungen zu den dortigen Fahrradfabriken. Er besaß sogar damals schon ein Auto – nicht so ein altes Vorkriegsgefährt, sondern einen fabrikneuen Opel-Olympia. Weil er selbst keine Kinder hatte, kam ich in den Genuss vielfältiger Geschenke. Das größte war natürlich der Roller mit Ballon-Reifen. Damals die neueste Erfindung und auch teuer, aber Onkel Erich saß ja an der Quelle. Ich wurde bewundert und war mit dem Roller die Sensation in der Sentastraße. Heute hört man oft den Begriff „Tretroller“ für die kleinen faltbaren City-Roller. Damals waren damit die Roller bezeichnet, die über dem Trittbrett noch ein bewegliches Wipp-Brett mit einer Zahnstange zum Antrieb des Hinterrades besaßen. Wir haben uns unzählige Wettfahrten um die Häuserblocks geliefert – aber ich, mit dem Ballon-Roller, war auch gegen größere Jungs, unschlagbar.


Meine Tante in der Sentastraße war Kriegerwitwe, hatte aber bereits 1947 wieder geheiratet und zwar einen Schneidermeister für Damen- und Herrenbekleidung. Er hatte seine Werkstatt mit Ladengeschäft drüben auf Neuhof und fuhr täglich mit dem Dampfer rüber. Seine Kunden waren Seeleute, die mit ihren Schiffen im Hafen lagen. Oft für zwei bis drei Wochen zum Löschen der Ladung. Da auch in der Handelsmarine früher noch Uniform getragen wurde, hatte er sein gutes Auskommen für deren neue Ausstattung. Durch Empfehlung hatte er auch einige Kunden in Barmbek, denn in der Wohnung gab es ein halbes Zimmer, was er zur Anprobe der Kunden nutzte. Einer dieser Kunden war Hans Apel aus Barmbek, der spätere Bundesfinanz- und Verteidigungsminister. Hans Apel war schon früh politisch aktiv und saß für die SPD in der hamburgischen Bürgerschaft. Für einen besonderen Staatsakt hat mein Onkel ihm seinen ersten Smoking geschneidert.
Die Wohnung meiner Tante war für damalige Zeit komfortabel: zur Sentastraße hin das Schlafzimmer mit einer gemütlichen Loggia und Morgensonne. Auf der anderen Seite gen Süden die Küche mit herrlichem Balkon und Blick auf den Sportplatz vom FC Paloma. Wenn am Sonntagnachmittag die 1. Herren spielten, hatte man einen formidablen, kostenlosen Logenplatz. Der Fußballplatz hatte damals noch keinen Rasenbelag, sondern „Grant“ und wenn Fußball gespielt wurde, war das bei trockenem Sommerwetter mit einer erheblichen Staubentwicklung verbunden, was die Hausfrauen in dem Block sehr verärgerte. Dieser Grant hatte aber auch eine positive Seite. Wir konnten stundenlang auf dem Platz hocken und die schönsten bunten oder glitzernden Steinchen herauspicken um sie zu sammeln, weil sie vermutlich sehr wertvoll waren. Später fanden wir heraus, dass dieser Grant lediglich geschredderter und gemahlener Trümmerschutt war.
Eines Tages geschah Ungeheuerliches: auf dem vierten Häuser-Block, der wie gesagt zerbombt war und nur noch aus Trümmerbergen und Mauer-Gerippen bestand, hatten zwei Jugendliche auf Altmetallsuche beim Klettern über die Schuttberge einen verschütteten Kellerzugang entdeckt. In einem der Kellerräume fanden sie ein ganzes Lager von Kästen mit Spielzeugbausteinen. Wir Kleineren hatten es erst bemerkt, als sich vor dem freigeräumten Kasematten-Fenster, eine Menschentraube bildete. Wir also auch dahin: es wurden dutzendweise diese Holzkästen herausgereicht und jeder, der einen Kasten ergatterte, lief schleunigst mit seiner Beute nach Haus. Diese Art Bauklötze kannte noch keiner – aber sie waren genial. Sie bestanden aus eingefärbtem Kunststein, ähnlich wie Speckstein. Sie hatten auf der Oberseite Noppen und auf der Unterseite entsprechende Mulden. Es gab sie als Quader in 1-er, 2-er, 3-er und 4-er Länge, in Säulenform und als Dachschrägen. Sie waren in Maß- und Winkelhaltigkeit so präzise hergestellt, dass sie ideal aufeinander passten ohne zu verrutschen. Das Prinzip ähnelte den späteren LEGO-Klemmbausteinen aber unsere hielten sich nur durch Schwerkraft. Wir hatten imposante Turmkonstruktionen bis über einen Meter Höhe gebaut, wenn sich mehrere von uns mit ihren Kästen zusammentaten. Leider ist mein Kasten im Laufe der Jahrzehnte verlorengegangen aber ich war so fasziniert von den Bausteinen, dass ich jahrelang danach Ausschau gehalten habe, leider vergeblich. Ich würde heute was drum geben, so einen Kasten wieder zu erwerben.
Wir spielten ja grundsätzlich „draußen“, denn ein Kinderzimmer hatte eigentlich keiner, sei denn er hatte noch 4 oder 5 Geschwister. Aber die Raumsituation in den Wohnungen war so prekär, dass dort einfach nicht gespielt werden konnte. Ich hatte auch einen Kameraden, der in den Nissenhütten in der Lohkoppelstraße wohnte, auch dort haben wir draußen gespielt. Aber wir, aus der Sentastraße, waren Fremdkörper dort. Vor der Bäckerei Ponsel war der Gehweg verbreitert, so dass eine entsprechende Spielfläche für „Hinkebock“, „Gummitwist“ oder „Kibbel-Kabbel“, für die Mädchen auch „Märchenball“ und „Meiersche Brücke“ bestand. Direkt dort stand auch so ein großer Feuermelder mit der Glasscheibe, die man einschlagen musste, wenn es brennt. Wenn es schummrig wurde, kamen auch die älteren Jugendlichen an die Ecke, es war ihr Sammelpunkt, sie alberten mit den Mädchen und standen herum: das waren die sogenannten „Eckensteher“.
Ein auffälliges Merkmal für Barmbek waren auch die riesigen Dampfwolken über der Gasanstalt zwischen Weidestraße und Osterbekstraße. Etwa alle Stunde wurde die ausgegaste, noch glühende Steinkohle aus den Kammeröfen ausgestoßen, in einen Kübelwaggon fallend, unter einem großen Löschturm, dann mit riesigen Wassermengen abgeschreckt, wodurch sich der enorme Dampfpilz bildete. Neben dem gewonnenen Leuchtgas war das Endprodukt dann Koks. Für uns Kinder war es unendlich interessant von der Brücke herab zu beobachten, wie die Kohlenschuten mit dem Nachschub über die Alster und den Osterbekkanal in den kleinen Werkhafen kamen. Mit langen Bootshaken wurden die Schuten dann per Hand so bugsiert, dass sie vom Greifer-Kran entladen werden konnten. Ein kleines Stück dieses Hafens ist noch heute zu sehen.
Eine eigenartige Erscheinung jener Zeit ist mir in Erinnerung geblieben: das waren die „Trampelpfade“ über die abgeräumten Trümmergrundstücke. Die Stadt Hamburg hatte schon frühzeitig nach dem Krieg mit der Beseitigung der Ruinen und Trümmerberge begonnen. Dadurch ergaben sich ungewohnte Sichtachsen, und man konnte in manche Richtung kilometerweit schauen. Von Barmbek aus waren gar die Kirchtürme in Innenstadt zu sehen. Weil alle Besorgungen ja zu Fuß gemacht wurden, konnte man sein Ziel schon von Weitem anvisieren und ging gerade darauf zu, also quasi „Luftlinie“. Deshalb benutzte man nicht mehr die Straßen und Gehwege sondern ging diagonal über die planierten Grundstücke. Und da es alle taten, entstanden diese Pfade. Obwohl im Laufe der Zeit schon meterhoch Unkraut hochwuchs, waren sie noch jahrelang zu sehen.
1951 wurde ich in der Schleidenschule eingeschult. Wir waren eine große Klasse mit über 30 Schülern, unser Lehrer war Herr M. Wenn Schüler schwatzten, hatte er die Angewohnheit mit seinem Schlüsselbund nach ihnen zu werfen. Eines Tages wurde in der Bank hinter mir laut getuschelt. Folge: Herr M. warf wieder mit seinem dicken Schlüsselbund und traf mich, als Unschuldigen, genau am Kopf. Sowas war damals halt ein Kollateral-Schaden, ohne Entschuldigung. Meine liebsten Spielkameraden waren jetzt auch meine Klassenkameraden. Reiner Heuer, Spatzi Koswig und Bernd von Paschkewitz, ich habe sie leider nicht wiedergesehen, weil ich mit den Eltern Ende 1951 nach Langenhorn, in eine Neubauwohnung mit Zentralheizung, umgezogen bin. Wenn sie noch leben, würde ich mich über ein Wiedersehen sehr freuen.

1. Schultag, Schleidenschule mit Reiner Heuer
 Klasse 1, 1951 mit Lehrer M.
Klasse 1, 1951 mit Lehrer M.
Barmbek Erinnerungen von Freddy Schnoor. Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegszeit in der Sentastraße
Auch ich, Friedrich-Karl, wurde geboren und zwar 1938, im Barmbeker Krankenhaus, als zweites Kind meiner Eltern Friedrich Schnoor, geb. 1879 und W. Schnoor. Meine Schwester wurde 1933 geboren. Wir alle kamen in Hamburg zur Welt. Unser Wohnort war immer Sentastraße 31. Unsere Großeltern wurden in den 1875er Jahren Hamburger.

Freddy Schnoor im Kindesalter
Ich fand früher schon, dass man nicht nur im Haus bleiben soll. Also spazierte ich mit ca. zwei Jahren Richtung Barmbeker Bahnhof. Aber sehr weit kam ich nicht. Am Osterbekkanal war der Ausflug bereits zu Ende.
Dann kam der 2. Weltkrieg. Meine Schwester kam mit der Kinderland-Verschickung nach Rückerstorf in Sachsen. Den Anfang des Krieges, September 1939, spürte man in Hamburg nicht, nur dass überall Bunker gebaut wurden, z.B. Turmbunker wie am Barmbeker Bahnhof. Ab Mai 1940 erreichte der Krieg mit Luftangriffen dann auch Hamburg. Da wir im Haus keinen Luftschutzbunker hatten, wurde der niedrige, kleine Keller im Haus (Erwachsene konnten dort nicht aufrecht stehen) mit Holzbalken abgestützt und der Lichtschacht mit einer Eisentür (auch als Notausstieg gedacht) verschlossen. Wenn da eine Bombe getroffen hätte…
Bei Alarm musste sofort der Keller aufgesucht werden. Wir Kinder waren so gedrillt, dass wir unseren kleinen, immer gepackten Koffer nehmen und schnell runtergehen mussten, oft nur in Nachtzeug. Man muss sich das so vorstellen, dass im Keller ein paar Kerzen brannten, alle anderen Räume aber kein Licht hatten. Es durfte kein Licht nach draußen dringen, es musste überall die Verdunkelung an den Fenstern dicht geschlossen sein. Wenn das nicht der Fall war, kam umgehend der zuständige Blockwart und es kam zu einer Anzeige.
Ich erinnere mich, trotz meiner Kindheit, an einige Details, die sich irgendwie eingebrannt haben. Z.B. holten meine Eltern immer ihre Zeitung in einem kleinen Laden, der auf der Seite des Paloma Platzes war. Ich ging immer mit, es gab immer ein Bonbon. Eines Morgens ging ich mit meiner Mutter hin und der Laden war zertrümmert. Die Scheibe war zerbrochen. Die Besitzerin begrüßte meine Mutter und gab mir eine Handvoll Bonbons. Ich bekam dort nie wieder welche. Meine Eltern sagten, die mussten „umziehen“. Später erzählten sie noch oft davon.
Da ich zu klein war, musste meine Mutter mit mir 1942 aus Hamburg raus. Mein Vater blieb zunächst in der Wohnung. Zuerst kamen wir – es war Winter – in Duvenstedt bei einer Tante unter, aber nicht im Haus, obwohl da Platz war, sondern im „Gartenhaus“. Das war eine fünfeckige Gartenlaube mit dünnen Fenstern und Bretterwänden, ohne Tür. Also nur für den Sommer geeignet. Irgendwie kam ein Vorhang als provisorische Tür davor, das war’s. Ohne jede Heizung und es zog überall. Essen durften wir wohl im Haus, aber Aufenthalt und Schlafen nur in der „Villa“, mit dünnen Decken und Eiszapfen an der Nase und überall Frostbeulen. Das war die liebe Verwandtschaft (oder zumindest doch ein Teil davon).
Durch Bekannte, die ein Gemüsegeschäft in der Sentastraße hatten und dort gleich zu Beginn der Angriffe ausgebombt wurden, kamen wir zum Glück aber bald nach Lauenburg/Elbe.

Die Hamburger Straße in Lauenburg
Aber noch war ja Krieg. Wenn über Hamburg die Angriffe waren und die Flugzeuge nachts mit den Flakscheinwerfern gesucht und beschossen wurden, schmissen diese Alustreifen ab, um die Ortung zu erschweren. Wir standen dann auf der Straße und beobachteten das „Schauspiel“. Hin und wieder flogen auch bei uns in Lauenburg Flugzeuge wohl in Richtung Hamburg und warfen die Aluminiumstreifen ab. Da meine Mutter eine sehr praktische Frau war, sammelten wir diese Streifen und schnitten sie der Länge nach nochmals durch. Fertig war unser Lametta. Was über war, wurde Weihnachten verschenkt, denn zu kaufen war ja nichts.
Hin und wieder fuhr meine Mutter mit mir nach Hamburg. Das war immer eine kleine Weltreise. Bei einer dieser „Heimreisen“ kamen wir in einen Bombenalarm – weit weg vom Bunker in Barmbek und von unserer Wohnung. Da sahen wir viele schreiende und brennende Menschen umherirren und viele in den Osterbekkanal springen. Ein anderes Mal kamen wir in die Sentastraße und sahen, dass unser Nachbarhaus Nr. 33 ausgebombt war. Nur noch ein paar Wände und die Decken standen. Im 1. oder 2. Stock hing noch ein Vogelbauer mit einem lebenden Vogel an der Wand. Davor stand noch ein Küchentisch, unter dem noch eine Frau hockte, die wohl durch den Luftdruck ums Leben gekommen war. Meine Mutter versuchte zwar, mich abzulenken, ich war aber viel zu neugierig und habe leider doch hingesehen. Ich sehe solche Bilder in Gedanken immer noch vor mir.
Aber wir haben ja trotz allem großes Glück gehabt. Wir sind noch mehrmals – zum Teil auf abenteuerlichen Wegen – nach Hamburg gekommen. So weit wie möglich mit der Bahn, eventuell nur bis Bergedorf. Den Rest dann zu Fuß oder mit dem Raddampfer von Lauenburg Richtung Hamburg. Wenn man Glück hatte – bis in den Hafen oder auch nur irgendwo vorher, je nach Kriegslage. Den Rest des Weges dann zu Fuß durch die Trümmerlandschaften. Egal von wo man kam, durch Rothenburgsort und Hammerbrook mussten wir ja immer und das waren die am häufigsten bombardierten Stadtteile in Hamburg, weil dort viel Industrie war. Eine gute Erinnerung an die Besatzungssoldaten habe ich auch noch. Ich glaube, es waren Engländer, denen wir auf einem unserer Hamburg Besuche, kurz nach dem Waffenstillstand 1945, irgendwo in der Nähe des Hafens in der Trümmerlandschaft begegneten. Sie riefen mich, ich solle zu ihnen kommen. Aber ich klammerte mich an meine Mutter. Da kamen sie zu uns und sprachen mit uns. Ich verstand ja kein Wort und als sie mir etwas geben wollten, habe ich es nicht genommen (man darf ja von Fremden nichts annehmen). Wir waren so gedrillt, nichts anzunehmen und aufzuheben. Es hätte ja vergiftet oder Sprengstoff sein können.
Meine Mutter hat mich dann doch überredet und ich bekam ein paar kleine eingepackte Tafeln. Da die Soldaten aber wohl sehen wollten, wie ich reagiere, wenn ich sie auspacke, blieben sie bei uns. Meine Mutter hat eine Tafel aufgemacht und mir ein Stück in den Mund gesteckt. Den Geschmack kannte ich nicht, fand ihn wohl gut und hörte von meiner Mutter, dass es Schokolade war. Das war die erste Schokolade in meinem Leben, da war ich schon ca. 7 Jahre alt.
Meine Eltern haben so oft wie möglich versucht, auf irgendeinem Weg nach Hamburg zu kommen, weil sie unsere Wohnung – bis auf ein Zimmer – Nachbarn aus der Sentastraße überlassen hatten, die sie kannten. Wenn meine Eltern zurückkämen – so die Absprache – sollte die Familie die Wohnung sofort räumen, was natürlich nicht geschah. Sie benutzten dann die ganze Wohnung mit unseren Möbeln. Meine Eltern haben sie dann von 1951 – 1953 rausgeklagt. Die meisten Möbel nahmen sie aber mit.
Die Häuser Sentastraße 29 und 31 sind im Krieg von der Zerstörung verschont geblieben, weil großes Glück im Spiel war. Bei dem größten Angriff auf Barmbek hatten zufällig zwei Bewohner des Hauses 31 Heimaturlaub und waren so im Haus. Sie kannten die Front. Ihnen war es egal, wo sie starben, so hörten wir später des Öfteren. Also stiegen sie aufs Dach der Häuser und fingen die langsam heruntersegelnden Brandbomben mit aufgespannten Wolldecken ab und drückten sie über den Dachrand auf die Straße. Alle Bewohner konnten sich bei den Beiden bedanken, dass alles – bis auf zersprungene Scheiben – heil blieb.

Die Sentastraße
Die Häuser von der Ecke Sentastraße (Gaststätte Hauenschild) bis Nr. 31 und 29 und dahinter bis zur Ecke Lohkoppelstraße waren alle zerstört, genau wie die gegenüberliegende Straßenseite ausgebrannt ist und nach dem Krieg unter Verwendung der Außenmauern wieder ausgebaut wurde.
Freddy (Friedrich-Karl) Schnoor, 2021
Barmbek Erinnerungen von Rainer Hoffmann. Meine Straße "Brüggemannsweg"in Hamburg, Barmbek-Nord
In dem magischen Alter zwischen „Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein“ und dem Erwerb des ersten Fahrrades, das aus Einzelteilen bei Fahrrad Richter an der Barmbeker Straße/Jarrestraße gekauft und von meinem Vater auf dem Boden in seiner „Werkstatt“ zusammengebaut worden war, bestand meine Welt aus 150 Metern Brüggemannsweg zwischen Meister-Bertram-Straße und Manstadtsweg in Hamburg-Barmbek in der Nähe des Barmbeker Krankenhauses.
Hier hat nicht der Kalender, sondern die Kleidung die Jahreszeiten festgelegt. Kurze Hosen – Frühling. Halb nackt im Rinnstein nach dem Gewitter oder später mit dem Fahrrad nach der Badeanstalt Ohlsdorf – Sommer. Lange Hosen – Herbst. Geschnürte Schuhe – Winter. Und die Arbeit, die bei Kindern „Spielen“ heißt: Murmeln waren Frühling, genauso wie Tretroller, Rollschuhe und Fahrrad, Messersteck, Länderklau, Kibbel und Kabbel, Springseil, Völker-, Fuß- und Treibball, Fußball-Wettkampf gegen die Nachbarstraße Lambrechtsweg, Fechten auf der „Victoria-Wiese“ waren Sommer. Mit der Räucherdose die Hauseingänge und die Umluft verpesten und Versteckspielen in den Hauseingängen war Herbst. Schneemänner auf dem Bürgersteig bauen und etwas später daraus Iglus fertigen, Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen auf dem zugefrorenen Bramfelder See waren Winter.

Indianer am Hauseingang Brüggemannsweg Nr. 5
Etwas später im Leben erste Kontakte mit dem anderen Geschlecht, doch für 12 Jungen gab es nur zwei weibliche Wesen in der Straße. Im Brüggemannsweg war das Klein- und Mittelbürgermilieu zu Hause. Und hier war Wirtschaftswunderland. Zu Beginn unserer Straßen-Fußballkarrieren standen in unserem Straßenabschnitt überhaupt keine Autos. Kamen welche mit ihrem Statussymbol auf Besuch, so wurden sie gebeten, 50 m weiter zu parken. Selbstverständlich kamen die Autofahrer dieser Bitte nach, wohl auch schon um den kostbaren Lack der Leukoplastbomber (Lloyd) oder später der Borgwards vor den Fußbällen zu schützen. Nur vereinzelt schafften sich die Erwachsenen nach und nach zuerst ein Moped, dann einen Motorroller und nach einiger Zeit auch die ersten Autos an. Bis 1956 stellten die Fahrzeuge für unseren Straßenfußball jedoch kein Problem dar, später verlegten wir unsere Spiele auf die Victoria-Wiese und traten in den Post-Sport-Verein ein, um dort unserer Fußballleidenschaft nachzugehen und mögliche Fußballkarrieren zu begründen. Das einzige Telefon in der Straße befand sich bei der Familie von E. im Haus Nr. 7. Es stammte noch aus der Zeit, als Herr von E. Blockwart der Straße im Auftrag der Nazis war und in seiner braunen Uniform umherlief. Im eigenen Haushalt ging es auch wirtschaftswundermäßig voran: Loewe-Opta Radio mit Magischem Auge, Kühlschrank, Elektroherd und ein Fernseher wurden nacheinander angeschafft.
Während der Block auf der gegenüberliegenden Seite die Nachkriegszeit beendete, indem dort Narag-Heizungen die alten Kohleäfen ablästen, war daran bei uns nicht zu denken. In unserer Familie wurde freitags noch die Zinkbadewanne in Betrieb genommen, und das Wasser dafür auf dem Gas- und Kohleherd erwärmt. Ich umging schon sehr frühzeitig diese Prozedur, indem ich im Schwimmverein in der Badeanstalt nicht nur meine Bahnen zog, sondern mich zweimal in der Woche auch beim Duschen im Bartholomäus-Bad („Badlo“) gründlich reinigte. Im Sommer duschte man während der Freibadesaison im Ohlsdorfer-Freibad, dafür gab es extra Duschmarken, an der Kasse zu kaufen. Damit konnte man sich eine begrenzte Zeit dann mit warmem Wasser im Duschraum einseifen und abduschen.
Die große Zinkbadewanne diente aber nicht nur als „Vollbad“, sondern auch als Waschbottich. Allwöchentlich wurde hier die Wäsche am offenen Fenster in dampfenden Wolken gekocht, gewälzt und auf der Ruffel (Waschbrett) malträtiert.

Die Straße Brüggemannsweg in Nord-Barmbek
von der Meister-Bertram-Straße aufgenommen, 2010
Auch nachdem der Kühlschrank schon angeschafft war, blieb der Tagesrhythmus meiner Mutter viele Jahre gleich. Sie kaufte täglich in der „Pro“ (Konsum Genossenschaft Produktion) in der „Fuhle“/Ecke Meister-Bertram-Straße ein. Alle Lebensmittel und Haushaltswaren waren dort zu erhalten, ein Schlachter gehärte genauso dazu, wie ein Milchladen und ein Backwarengeschäft. Die Leute, die dort kauften, hatten das Ansehen wie die Käufer bei Aldi in der Anfangszeit in den späten 1960er-Jahren.
Zumal sie mehrheitlich Anhänger der SPD (Sozial Demokratische Partei Deutschlands) waren. Den Unterschied zum Heute markiert das Soziologen-Wörtchen „soziale Kontrolle“. Die Straße war unser Wohnzimmer. Mutter musste sich nicht vom Schulschluss bis zum Einbruch der Dunkelheit aus dem Fenster hängen, um den Sohn im Blick zu haben. Mindestens ein halbes Dutzend Augenpaare spähte uns Kinder aus, angefangen von den beiden Nachbarinnen unter uns, die auch schon mal mit einem Gegenstand nach uns warfen, wenn sie meinten, wir würden sie stären. Die Familie J. war immer auf dem „Kiwief“, da sie sofort den Fußball einkassierte, wenn der Ball in ihren Vorgarten fiel. Wir schafften es zumeist nicht, vor ihnen in den Garten zu gelangen. Sie beobachteten uns rund um die Uhr. Später sollten wir uns bitter an ihnen rächen. Frau Pfeiler passte auf dem obersten Stock auf, dass Herbert, Manfred oder „Puttchen“ (Karl-Heinz war der Nachkämmling) nicht mit den neuen Stiefeln Fußball spielten. Wir hatten immer einen Blick nach oben gerichtet, um das Bewegen der Gardinen sofort an die drei weiterzugeben. Dann standen sie teilnahmslos am Straßenrand unseres Fußballfeldes und markierten die Schiedsrichter.
Regelmäßig kam auch der Polizist vorbei, mit dem Tschako auf dem Kopf. Er war unser Udl und wollte nicht der Feind der Kinder sein, wenn er von Frau und Herrn J. zum wiederholten Male gerufen wurde, da wir in der Straße Fußball spielten und vielleicht auch eine Fensterscheibe eingeschossen hatten. War dies geschehen, hielten wir kurz und entsetzt mit dem Spielen inne, gingen zu den Eltern und sammelten 30 Pf. pro Spieler ein. Mit „eingezogenem“ Kopf ging dann einer von uns zu der Nachbarin hin, wo das Unglück geschehen war und übergab den Betrag. Besonders günstig war es, wenn einer unserer Mitspieler aus der Familie der „Geschädigten“ stammte. Bei J. gestaltete sich die Angelegenheit weitaus komplizierter! Erst einmal bekamen wir den Ball nicht zurück. Von uns wagte sich bald keiner mehr zur Familie, da sie unsere erklärten Feinde waren. Mütter wurden als Diplomaten vorgeschickt, doch J. verweigerten sich häufig und riefen die Polizei. Zu unserem Glück hatte unser Udl diplomatisches Geschick und läste den Ball gegen die Gebühr für die Reparatur wieder aus. Er verwarnte uns mit einem Augenzwinkern in Gegenwart der J., ihr Neffe war ein bekannter Schauspieler. Bei unseren Eltern entschuldigte der Polizist sich für seinen dienstlichen Auftrag, und uns gegenüber sagte er an der Ecke Manstadtsweg, wo J. ihn und uns nicht sahen: „Jungs, ich habe selbst Kinder, ihr müsst aber ein bisschen vorsichtiger spielen!“

Rainer im Brüggemannsweg mit den Audi 60 auf dem
Weg zur Hochzeitsfeier von Petra u. Wolfgang, 1971
Besonders markant waren auch die Geräusche auf der Straße, wenn die Stadt erwachte. Gegen 04.00 Uhr härte man bei offener Fensterklappe die ersten Straßenbahnen klingeln, die die Fußgänger von den Schienen in der Fuhlsbüttler Straße vertrieben. Bald klapperte es laut, wenn der Milchwagen, ein LKW voller großer Milchkannen aus Blech, die lose Milch zu den Milchhändlern brachte. Die Flaschenmilch klapperte nicht viel weniger, sie wurde aber später ausgeliefert. Milch in Papp-Packungen war noch nicht erfunden. Natürlich begannen auch auf den großen Linden-Bäumen die Vägel ihr Gezwitscher und die Tauben gurrten. Die Bäume sind längst gefällt und durch neue Anpflanzungen ersetzt. Fußballspielende Kinder sieht man nicht mehr auf der Straße.
Rainer Hoffmann, 2021
Das Buch zur Lebensgeschichte von Rainer Hoffmann ist in unserem Onlineshop erhältlich
Barmbek Erinnerungen von Uwe Preuß. Vorfall an der Langenfortschule (1951/52)

Schule Langenfort 1960
Mein Bericht beinhaltet keine Heldentat, ist nicht weltbewegend, nicht lustig, nicht traurig, sondern steht für sich. Vielleicht ist er sogar langweilig, verwirrend und uninteressant. Meiner Meinung nach wirft er ein kleines Licht auf die Nach-Nazizeit.
Es muss nach meiner Erinnerung 1951/52 gewesen sein, als wir aus beengten Untermieterverhältnissen in der Sierichstraße nach Barmbek in das Haus in der Steilshooper Straße Nr. 191 in die „eigene“ Mietwohnung gezogen waren. Besuchte ich vorher 1 Jahr lang die Grundschule in der Voßstraße am Stadtpark, so war ab jetzt die Schule in der Langenfortstraße meine Grund- schule (2. Klasse, Klassenlehrerin Frau Günzel). Das ist mein Bezugspunkt zu Barmbek.
In der Schule herrschte die Regel, dass nach der Pause im Schulhof nach dem Klingelzeichen die Jungen in das rechte Tor und die Mädchen in das linke Tor gingen. Die Treppe hoch zu den Klassenräumen müsse „gesittet“ und langsam benutzt werden. Soweit die Theorie! In der Praxis aber war es so, dass vor und nach dem Tor und die Treppe hinauf immer eine Drängelei und Schieberei stattfand.
Zu Beginn meiner Schulzeit, als ich in der Langenfortschule noch neu war, steckte ich in solch einem Geschiebe auf der Treppe, nachdem die Schulhof- klingel getönt hatte. Oben auf dem Treppenabsatz stand die Pausenaufsicht, eine ältere Lehrerin (deren Namen ich nicht genau erinnere; ich nenne sie hier Frau Meier). Sie winkte mich aus der Menge heraus zu sich. Ich, -ein- gedenk der Ermahnungen meiner Mutter, den Anweisungen der Lehrer immer nachzukommen – kämpfte mich durch zur Lehrerin. Ich biss aber, als ich mich ihr näherte, noch schnell von meinem Schulbrot ab, das ich von zu Hause mit- bekommen hatte. Ich kaute das Brot, als ich vor ihr stand. Da fing sie an zu schimpfen, etwa so, dass ich kein Benehmen hätte, in ihrer Gegenwart zu essen. Und ehe ich mich versah, hatte ich eine Ohrfeige weg. Mir ist jetzt nicht in Erinnerung, ob ich noch weitere Belehrungen bekam, z.B. wie man die Treppe zu benutzen habe. Zu solchen Hinweisen wäre ja -rückblickend betrachtet- Anlass gewesen. Ich muss dann in den Klassenraum geschickt oder gelassen worden sein und wie ich den Unterricht in der Klasse hinter mich gebracht habe, ist mir auch entfallen.
Mittags nach der Schule berichtete ich den Vorfall meiner Mutter. Sie sagte nichts dazu. Sie muss ihn aber meinem Vater mitgeteilt haben, der immer abends von der Arbeit nach Hause kam; denn mein Vater fragte mich zu dem Vorfall aus. Er regte sich sich ganz fürchterlich auf. Er wollte darüber mit dem Schulleiter sprechen. Heute würde ich sagen, er wollte eine Dienstaufsichsbeschwerde ein- legen. Damals kannte ich natürlich den Begriff und die Sache nicht. Ich konnte keinen Zusammenhang zwischen der Ohrfeige und dem Schulleiter sehen, war froh, dass ich nicht das Ziel des Unmuts meines Vaters war.
Am nächsten oder übernächsten Tag in der Schule erklärte mir ein größerer Schüler, der den Vorfall wohl mitbekommen hatte, dass „die alte Frau Meier im ‚Kaazett‘ gewesen wäre“. Er sagte es so, als sei das ein Makel der Lehrerin, jedenfalls hatte ich ihn so verstanden. Ich konnte mit der Information des Mitschülers eigentlich nichts anfangen, hatte aber ein neues Wort gelernt. Und dieses Wort, das ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte, überbrachte ich mittags meiner Mutter mit dem Bemerken, dass Frau Meier im „Kaazett gewesen wäre“.
Wenn ich gedacht hätte, dass meine Mutter durch meine Nachricht wie mein Vater explodieren würde, so hatte ich mich sehr getäuscht. Meine Mutter verhielt sich wiederum indifferent. Und auch mein Vater fragte mich nicht nach Frau Meier. Als ich ihm dann von mir aus von dem „Kaazett“ erzählte, war er nicht daran interessiert. Für ihn war die Sache erledigt, für mich ganz unerklärlich und plötzlich. Wir erwähnten das Ereignis aber auch nie wieder in der Familie. Erst jetzt nach 70 Jahren taucht die Erinnerung wieder auf.
Nach allem glaube ich, dass mich die ganze Angelegenheit irgendwie beeindruckt hat, sonst wäre sie nicht wieder nach so langer Zeit erschienen. Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, dann vermute ich sogar, dass mich der Vorfall auch ein wenig geprägt hat.
Ansonsten ist mir von der Schulzeit in der Langenfortschule wenig im Gedächtnis geblieben.
Uwe Preuß, 2021
Barmbek Erinnerungen von Christa L. Tank. ?!Heimat – Barmbek!?
Was ist Heimat? Wo ich geboren und aufgewachsen bin – Wolfsburg? Oder die Städte, wo ich jahrelang gelebt und gearbeitet habe – Stuttgart, München, Sao Paulo, Rio??? Wie die Lateiner sagen: Ubi bene, ibi patria = auf gut plattdütsch: wo meine Beene sind, bün ick to huus! Vor gut vier Jahren bin ich nach Hamburg umgezogen. Eigentlich wollte ich gar nicht nach Barmbek, aber das Schicksal bescherte mir die hübsche kleine Wohnung eines Freundes, der in die Schweiz auswandern wollte und müde vom ständigen Hin und Her bin ich geblieben. Streng genommen ist es auch gar nicht Barmbek, sondern Süd-Bramfeld, aber die Grenzen sind fließend und ich bin eine Grenzgängerin.
Ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Wo findet man sonst noch so viel Natur mitten in der Großstadt? Ich bin umzingelt von Supermärkten und Bushaltestellen, aber die Eichhörnchen kommen und vergraben ihre Nüsse in meinen Balkonkästen; die Graureiher kreisen überm Haus und haben es auf die kostbaren Koi-Karpfen im Gartenteich des Nachbarn abgesehen…
Heimat – das sind im Frühling die hellen zarten Blüten eines Mandelbaums vor der düster-roten Backstein-Architektur, die mir eigentlich gar nicht liegt…Das ist der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst im Abendrot… Das sind Klönschnacks mit den Nachbarn, die man auf der Treppe trifft, und mit den Freunden, über die man beim Shoppen auf der Fuhle stolpert.
Heimat – das ist Susanne, die mit ihren drei Frettchen an der Leine ihren Abendspaziergang an der Seebek macht, die die lieben Tierchen schon so lange zu untertunneln versuchen…Das ist der schwarze Schäferhund Charly, der vor dem Kiosk Ecke Pfenningbusch/Langenrehm mit so viel Begeisterung Skatebord fährt, dass er dich glatt ummöbelt, wenn du nicht rechtzeitig aus dem Weg springst…
Heimat Barmbek – das ist das Tanzcafé für Junggebliebene, wo das Gruftieschubsen oder Mumienschieben so flott ist, dass ich mir schon so manche Blase an den Hacken getanzt habe. Das heißt: wenn ich klassisches Paartanzen möchte, parke ich mein Auto am unteren Ende der Stückenstraße, und wenn ich alternativ tanzen gehe, einzelweise, barfuß, in rauchig- und alkoholfreier Atmosphäre, parke ich am oberen Ende der Stückenstraße…Und gleich um die Ecke wohnt Inge, die ihre Freunde zu ihren leckeren Freßchen einlädt…
Heimat Barmbek – das ist der sommerliche Biergarten im Bürgerhaus… Kaum zu glauben, aber beim Stadtteilfest saß ich dort auf einer Bank neben einem der Organisatoren – der hatte ein Schild auf der Brust mit einem nicht sehr üblichen Namen, der mir jedoch wohl bekannt war. Ich sprach ihn darauf an, wir gingen der Sache auf den Grund mit dem Resultat, dass er mir sagte: Dann bist du also meine Großcousine – herzlich willkommen!
Wirklich, die Welt ist ein Dorf – Heimat Barmbek eben!!!
Christa L. Tank, 2020 der Geschichtswerkstatt übergeben
Barmbek Erinnerungen von Prof. Dr. Holger Knudsen. Eine Kindheit in der Mirowstraße 1950 bis 1960. Eine schöne Zeit, aber an die kalten Winter denke ich ungern zurück

Holger Knudsen mit Momo
vor der Haustür, 1952
Meine Eltern (beide Hamburger in der 5. Generation) wurden nach ihrer Heirat 1948 wegen der großen Wohnungsnot nach dem Krieg bei einem Ehepaar mit unzerstörter großer Wohnung in der Lenhartzstraße (Eppendorf) zwangseingewiesen und da habe ich die ersten Lebenswochen verbracht. 1950 bekamen wir eine Wohnung in der Mirowstraße 10, 4. Stock Mitte – die Stätte meiner Kindheit. In diesem Haus befanden sich bis zur Ausbombung auf jeder Etage zwei Wohnungen; nach dem Krieg wurden die Grundrisse verändert und innerhalb der erhaltenen Fassaden zur Wohnraumschaffung auf jeder Etage drei Wohnungen eingerichtet (vor einigen Jahren wurde alles wieder in den Originalzustand mit zwei Wohnungen pro Etage zurücksaniert). Das hatte zur Folge, dass wir einen großen Flur hatten (da standen die Schränke) und eine geräumige Küche (der Flur war mein Spielplatz, in der Küche habe ich die Schularbeiten erledigt), stattdessen aber nur zwei winzige Zimmerchen, die als Wohn- und Schlafzimmer dienten und eine sehr kleine fensterlose Nasszelle mit Dusche und Toilette. Aber Kinder nehmen die Dinge, wie sie sind, als „normal“ wahr. Während die Enge für meine Eltern ziemlich qualvoll gewesen sein muss, hat sie mich nicht gestört. Ich hatte mir immer ein Geschwisterchen gewünscht, aber trotz der auf der Fensterbank ausgelegten Zuckerstücke „für den Storch“ (die auch immer „abgeholt“ wurden) hat es sich nie eingestellt: meine Eltern wollten sich wegen der Enge kein weiteres Kind leisten. Deshalb war auch mein zweiter Wunsch, ein Hund, nicht erfüllbar. Ich durfte stattdessen einen Hamster haben. Hamster sind nachtaktive Tiere, ich habe aber, natürlich unwissend, immer tagsüber ziemlich intensiv mit ihnen gespielt. Ich tue Abbitte bei Putzi, Nicki und Hansi, die dadurch vielleicht vorzeitig in den Hamsterhimmel gekommen sind. Dazu im Kontrast steht aber, dass ich am Alter von neun Jahren mit Zustimmung meiner Eltern von Ilona, der etwas älteren Nachbarstochter mit den hinreißenden langen Zöpfen, als Mitglied des Hamburger Tierschutzvereins geworben wurde. So bin ich also seit mehr als sechzig Jahren Mitglied, war aber nie aktiv.

Holger Knudsen mit Nicki, 1959
Mein Vater war kaufmännischer Angestellter mit Arbeitsplatz am Ballindamm (bis zur Einstellung des Linienverkehrs im Jahr 1984 fuhr er mit dem Alsterdampfer ab Saarlandstraße hin und wieder zurück); meine Mutter war Fremdsprachenkorrespondentin mit Arbeitsplatz bei einem Tee-Makler in der Speicherstadt. Während meiner Kindheit war sie (wie es damals vielfach üblich war) zwölf Jahre lang Nur-Hausfrau. Später hat sie dann wieder in ihrem erlernten Beruf gearbeitet.
Ich wurde geboren am 3. Mai 1949. Ich hatte mir Zeit gelassen (wie es durchaus meinem Charakter entspricht) und meine Geburt war mehr als überfällig. Wäre ich bis zum 30. April geboren worden, dann hätte man mich als einen der jüngsten Schüler eingeschult; durch die späte Geburt hat sich meine unbeschwerte Kindheit um ein Jahr verlängert und ich war fast sieben, als ich zur Schule kam. So war ich immer der älteste in der Klasse. Ich habe schon häufig darüber nachgedacht: wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich ein Jahr früher eingeschult worden wäre? Aber da ich ziemlich viel Glück im Leben hatte und häufig im richtigen Moment am richtigen Platz war, gehe ich jedenfalls davon aus, dass es privat und beruflich nicht viel besser hätte laufen können.
Ich habe meiner Mutter gerne beim Waschen zugesehen. Für die Häuser in der Mirowstraße gab es eine große Waschküche mit einem großen runden Waschbottich in der Mitte. Das Wasser wurde erhitzt, Waschmittel hinzugegeben, die Wäsche lange mit einem Knüppel umgerührt und gewalkt, dann zur Fleckentfernung über das Waschbrett gezogen und schließlich, nass und schwer, mit dem Waschkorb über sechs Stockwerke zum Trockenboden befördert. Sklavenarbeit! Da ist es gut verständlich, warum meine Mutter sich so sehr über ihre erste Waschmaschine freute.
Die magischen und endlosen Sommer waren schön. Da es aus den geburtenstarken Nachkriegsjahrgängen viele Kinder gab, fand man immer jemand zum Mitspielen. Ich hatte einen schönen Tretroller mit Ballonreifen, wir haben Verstecken gespielt, „Mutter und Kind“, Hüpfspiele, mit Ball und Springtau, die „Meiersche Brücke“ (ich hatte die Regeln vergessen, jetzt aber gesehen, dass es im Internet eine schöne Beschreibung gibt) und andere Spiele, deren Namen ich vergessen habe. Dann gab es noch das Marmeln mit dem Ziel, am Ende mehr Kugeln als zu Spielbeginn zu haben. Es gab Tonkugeln („Pi-Marmeln“), kleine Glaskugeln und große Glaskugeln. Fünf Tonmarmeln waren so viel wert wie eine kleine Glasmarmel und zehn so viel wie eine große. Zur Aufbewahrung hatte jedes Kind einen „Marmelbeutel“. Es wurde nie langweilig. Im Sommer war der Hinterhof ein idealer Spielplatz. Es gab aber ein Problem: den Sheriff! (für lange Zeit mein einziges englisches Wort). Während Konflikte unter den Erwachsenen so diskret behandelt wurde, dass wir Kinder davon nichts mitbekamen, war der Hausmeister stets zur Stelle, wenn nach seiner Meinung irgendwo Unordnung herrschte. Seine Lieblingsopfer waren die Kinder im Hof. Ich hatte Angst vor ihm. Der Sheriff war wohl, wie sein berühmter Landsmann Budnikowsky, nach dem ersten Weltkrieg in Deutschland hängengeblieben.

Holger Knudsen, Aufnahme
vom Wanderfotographen, 1954
Die Mirowstraße war Spielstraße, denn es gab nur ein Auto. Ein Nachbar war Vertreter und er hatte einen damals schon betagten Mercedes mit sehr breiten Trittbrettern. Er war kinderlos und es brachte ihm Freude, uns etwas auf den Trittbrettern (gut festhalten!) mitfahren zu lassen. Ich erinnere mich besonders an eine Fahrt, ganz langsam, zweimal um den Block. Glücklicherweise ist nie etwas passiert. Später hatte er dann einen Borgward (Isabella). Autos waren so selten, dass ich mich noch an den nächsten Wagen erinnere: der Ford Taunus (der mit der Weltkugel über dem Kühlergrill) von Frau Aue, der stellvertretenden Direktorin der Volksschule in der Schleidenstraße. Eine Sensation! So ein großes Auto! Der nächste Wagen in meiner Erinnerung war schon etwas bescheidener: der Lloyd Alexander von Junglehrer Krüger. Naja, wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd, wer den Tod noch lieber hat, fährt Goliath. In der ehemaligen Volksschule in der Schleidenstraße ist jetzt das Arbeitsgericht Barmbek untergebracht und im dritten Stock wurde ein kleines und sehr sehenswertes Schulmuseum eingerichtet. Da tauchen die eben genannten Protagonisten wieder auf.
Meine Eltern waren brave Kirchensteuerzahler, aber überhaupt nicht religiös. Sie hatten nichts dagegen, dass ich regelmäßig zur Kinderstunde bei Diakonisse Schwester Gertrud im Gemeindehaus ging. Das hat auch deshalb Spaß gemacht, weil es da nicht nur Kinder aus der näheren Umgebung gab.
Die Winter waren anders, viel kälter als heute. Mein Vater musste dann immer Kohlen und Briketts mit der Schütte vier Stockwerke hoch aus dem Keller holen, damit es morgens einigermaßen warm war. Aber richtig angenehm wurde es selten. An den Fenstern gab es dicke Eisblumen und wenn man rausschauen wollte, dann musste man lange mit warmem Atem ein kleines Loch in das Eis pusten. Insbesondere vor dem Einschlafen musste man lange strampeln, bis das Bett ein wenig warm wurde. Denn das Schlafzimmer war nicht beheizbar. Daran denke ich sehr ungern zurück. Die Kohlen wurden im Herbst angeliefert, genau wie die Kartoffeln. Der Bauer ging von Tür zu Tür und nahm die Bestellungen entgegen. Wenn die Kartoffeln geliefert wurden (am Anfang mit Pferdwagen, später mit einem Treckergespann) war das ein großer Spaß. Die größeren Jungs durften oben auf den Kartoffelsäcken ein Stück mitfahren und beim Ausladen helfen. Für die Lagerung gab es eine Miete in jedem Keller. Das musste für den Winter reichen. Es wurden damals viel mehr Kartoffeln gegessen als heute. In jedem Hausflur stand eine Tonne für die Kartoffelschalen und Bauer Eggers holte sie als Schweinefutter einmal in der Woche mit seinem Dreirad („Goliath“) ab. Der Osterbekkanal war fast immer zugefroren und man konnte prima „glitschen“ und Schlitten fahren. Es hat auch Spaß gemacht, Schneemänner zu bauen. Kohlenstücke für die Augen bekam man immer, aber die Mütter rückten die Karotte (in Hamburg damals „Wurzel“ genannt) für die Nase ungern raus. Das war die Generation, die ganz große Probleme mit dem Zweckentfremden von Essbarem hatte. Meistens musste ein Zweig helfen.

Mit Marion, Michael (links) und Dagmar im Hinterhof,
ohne den Sheriff. 1955
Im Winter spielte ich gern mit meiner elektrischen Eisenbahn. Beide Lokomotiven und die Schienen waren neu, aber die Wagen hatten meine Eltern gebraucht gekauft. Damals hat mich das sehr betrübt, aber heute haben diese alten Wagen aus Blech einen beträchtlichen Sammlerwert. Ich habe sie noch.
Ich war an kalten Tagen gern drin und solange ich nicht lesen konnte, hörte ich viel Radio. Das konnte ich schon früh bedienen. Wir hatten ein Röhrengerät von Philips „Super Merkur“ für Mittelwelle, Kurzwelle, Langwelle. Ein riesiger Kasten, so groß, dass ich als sehr kleines Kind dachte, kleine Männchen darin würden das Programm machen. Mit einigermaßen Qualität war nur der Sender Hamburg (es gab nur ein Programm) des NWDR auf der Mittelwelle zu empfangen. Dazu musste aber der Knopf für das „magische Auge“ sehr sorgfältig gedreht werden. Ich hörte gern die Märchenstunde mit Eduard Marks (eine unvergesslich sonore Stimme, die es jetzt auch wieder im Internet zu hören gibt), den Kinderfunk (vor allem „Kalle Blomquist, der Meisterdetektiv“) und auch schon den Schulfunk, bevor ich zu Schule kam (insbesondere „Neues aus Waldhagen“, eine Art didaktische Radio-Novela für Kinder, jetzt auch im Internet). Ich spielte gern mit dem Zeiger und die unverständlichen Stimmen aus fernen Ländern und der Weite des Äthers haben eine große Faszination auf mich ausgeübt. Die Lieblingssendung meiner Mutter war „17 und 4“. Sonntags gab es die „Schönen Stimmen“ und das „Hafenkonzert“. Diese Sendestunden waren für meinen Vater reserviert. Aber das machte nichts, weil ich zu der Zeit ohnehin in die Heiligengeistkirche in den Kindergottesdienst bei Pastor Gleß oder Pastor Ottmer und Diakon Ferlau ging. Nach dem Mittagessen durfte ich sonntags zur Kindervorstellung ins Roxy oder Scala (beide Fuhlsbüttler Straße) oder Bali (zwischen Hamburger Straße und U-Bahn Dehnhaide) gehen. Der Einheitspreis betrug 50 Pfennig. Im Sommer bekam ich für das Freibad Dulsberg zusätzlich zum Eintrittspreis 20 Pfennig oder „zwei Groschen“. Dafür konnte man vier Salinos, 20 „Liebesperlen“ oder vier Tüten Ahoi-Brausepulver kaufen.
Eine frühe Erinnerung hängt mit dem Radio zusammen: die Ungarnkrise 1956. Die Erwachsenen waren sehr besorgt und es war die Rede von „Krieg“. Ich hatte keine Ahnung, was das sein könnte, aber mein Eindruck war jedenfalls, dass dieses sehr abstrakte Ereignis etwas sehr Unangenehmes sein müsste.
Einen Fernseher bekamen wir erst 1965, und so war das Radio unser Fenster in die Welt. Meine Tante aus Ohlstedt hatte schon Mitte der fünfziger Jahre einen Fernseher, ein großer Kasten mit kleinem Bildschirm. Um ihn zum Laufen zu bringen, musste man in einen an der Rückwand angebrachten Behälter zwei Mark einwerfen und dann lief das Programm für einige Zeit und musste dann durch weiteren Geldeinwurf reaktiviert werden. Ab und zu kam der Händler und leerte den Geldbehälter, bis das Gerät abbezahlt war. Da sonst niemand einen Fernseher hatte, war es bei Familienfesten ein Vergnügen, reihum zwei Mark auszugeben, um fernsehen zu können. Da kam einiges zusammen. Ein Telefon hatten wir nicht und auch sonst niemand im Haus. Wer telefonieren wollte, musste zum „Öffentlichen Fernsprecher“ im Postamt am Flachsland gehen, natürlich nur während der Öffnungszeiten. Telefonzellen gab es am Bahnhof Barmbek und am Bahnhof Dehnhaide, aber man konnte nie sicher sein, dass sie funktionieren.
Meine Eltern hatten das „Hamburger Abendblatt“ abonniert (damals noch eine echte Abendzeitung) und mein Vater, sonst sehr friedlich, konnte ungehalten werden, wenn er in unserer engen Wohnung nach der Arbeit nicht gemütlich in seinem Sessel seine Zeitung lesen konnte. Ich hatte sonst ziemlich viele Freiheiten und nur, ab einem gewissen Alter, zwei Pflichten. Den Müll zum „Ascheimer“ bringen und einzukaufen (damals in Hamburg „Einholen“ genannt). Um vom Haus 10 zum Ascheimerkeller im Haus 16 zu kommen, gab es zwei Möglichkeiten: entweder auf der Straße am Block entlang oder durch den Keller. Auf der Straße bestand die reale Gefahr, mit dem Mülleimer in der Hand zum Spott der „halbstarken“ Jugendlichen zu werden, in den völlig verwinkelten, unübersichtlichen, nur mit kurzem Minutenlicht sehr schlecht beleuchteten und recht gruseligen Kellergängen hatte ich Angst vor irrealen Gefahren. Da das Fehlen von Selbstbewusstsein bei mir noch größer als die Angst war, habe ich mich meistens für den Gang durch den Keller entschieden. Aber das ist keine schöne Kindheitserinnerung.
Und noch eine unangenehme Kindheitserinnerung: Spinat und Lebertran („du willst doch groß und stark werden“), aus einer in der Apotheke abgefüllten und wenig kindgerechten braunen Glasflasche. Spinat esse ich bis heute nicht.
Angenehmer war das Einkaufen beim Krämer Strahl, Brucknerstraße/Ecke Käthnerort. Das war kein Tante-Emma-Laden, sondern ein ziemlich großes Geschäft mit mehreren Mitarbeitern. Man gab die Bestellung auf und wurde über den Tresen (hamburgisch „Tonbank“) bedient. Beim Rausgehen gab es einen Bonbon für jedes Kind. Mit dem Aufkommen der Supermärkte konnte Familie Strahl mit den vorhandenen Baulichkeiten den neuen Zeiten leider nichts entgegensetzen das war ein schleichender Prozess. Durch das gleichzeitige Kinosterben wurden plötzlich große Hallen frei: perfekt geeignet für die neuartigen Supermärkte. Wirklich schade, das waren überaus korrekte Geschäftsleute, die auch mal anschrieben, wenn am Monatsende das Geld knapp war. Milchprodukte wurden bei Meesen im Käthnerort gekauft (nicht abgepackt, sondern mit der Milchpumpe in die Milchkanne), Fisch bei Kluziak in der Fuhlsbüttler Straße, sonntags gab es sehr leckeren Kuchen, das Stück für 30 Pfennig, von der Konditorei Ponsel in der Brucknerstraße.
Für größere Einkäufe ging es in die Fuhlsbüttler Straße („Fuhle“) und ich erinnere mich an ein ganz besonderes Großereignis: die Eröffnung des Plastikkaufhauses! Alles aus Plastik, sogar die Blumen („sieht echt aus, muss aus Plastik sein“). Nicht billig, aber so fühlte man sich als Teil einer neuen Zeit. Es war ein echter Hype! Die Schuhe, die ich gelegentlich neu brauchte, wurden auf meinen Wunsch hin bei Salamander in der Fuhle gekauft. Denn nur dort gab es die Hefte von „Lurchi und seine Freunde“ und auf die war ich sehr scharf. Bei Salamander gab es ein Gerät, angeblich ungefährlich, mit dem die Füße durchleuchtet werden konnten. Man sah dann auf dem Bildschirm die eigenen Fußknochen (oder die des Kindes) und den Umriss der Schuhe. Das war bei der Kaufentscheidung nützlich, aber es hat sicher seinen Grund, dass es diese Geräte nicht mehr gibt. (Meine klein gewordenen Schuhe und Kleidungsstücke, soweit gut erhalten, gingen an eine Schulfreundin meiner Mutter, die elf Kinder hatte).
Manchmal ging ich mit meiner Mutter ins Zentrum „in die Stadt“. Um Geld für die Fahrkarte zu sparen, liefen wir oft auf dem Hinweg zu Fuß, aber dafür gab es dann leckeren Fisch bei Daniel Wischer in der Spitalerstraße. Erst viel später ist mir bewusst geworden, wie sehr und wo meine Mutter gespart haben muss, um das finanzieren zu können. Zurück fuhren wir entweder mit der Ringbahn oder mit der Straßenbahn, Linien 6 oder 9. Ich fuhr besonders gerne mit den ganz alten U-Bahnen aus der Vorkriegszeit, denn mit etwas Glück konnte man den Schaffnerplatz neben der Fahrerkabine ergattern und nach vorne ausgucken wenn meine Mutter ins Ortsamt musste, wollte ich sie immer begleiten. Denn da konnte man mit dem Paternoster fahren und den Grusel der Extra-Durchfahrt durch den Keller oder über den Dachboden für einen kurzen Moment genießen.
Meine Eltern waren aktiv im Wanderverein „Die Naturfreunde“ (da hatten sie sich kennengelernt) und sehr, sehr selten, wenn wir etwas müde zurückkamen, spendierte mein Vater ein Essen bei Koch’s Mittagstisch am Barmbeker Bahnhof. Frivoler Luxus! Bedienung am Tisch! Weißgekleidete Kellner! Unvergesslich!
Zum Thema Fahrkarte: die Verkehre der U-Bahn und der S-Bahn waren bis zur Schaffung des HVV völlig getrennt. Fahrkarten konnten nur am Schalter gekauft werden und da konnte es schon mal eine lange Schlange geben (in der Straßenbahn erfolgte der Kauf beim mitfahrenden Schaffner). Bei der S-Bahn wurden die Fahrkarten vor dem Aufgang zum Bahnsteig entwertet. Im Barmbeker Bahnhof wurde das von Kriegsversehrten ohne Arme oder Hände erledigt, die dafür eine eigens eingerichtete Kabine hatten. Man legte die Fahrkarte in eine Fassung und sie bedienten die Entwerterzange dann mit einem Fußhebel. Das hat mich immer sehr verwirrt (aber auch fasziniert), genauso wie die Kriegsblinden, die im Hauptbahnhof mit Hilfe von riesigen Folianten in Blindenschrift Fahrplanauskünfte gaben. In der Spitalerstraße (damals viel befahrene Verkehrsachse) sah man noch Jahre nach dem Krieg sommers wie winters einen Kriegsblinden, der Bürsten verkaufte. Ich hatte mir immer vorgestellt, mit meinem ersparten Taschengeld bei ihm einmal als Geburtstagsgeschenk für meine Oma eine kleine Bürste zu kaufen. Aber als ich vor ihm stand, war ich beklommen und zu schüchtern, ihn anzusprechen. Und irgendwann war er nicht mehr da.

Schulhof Schleidenstraße. Mit Fräulein Martens, 1956
Mit dem Schulbeginn änderte sich alles. Bei Fräulein Martens lernte ich schnell Lesen und Schreiben, mit dem Rechnen ging es nicht so schnell. Fräulein Martens war gelernte Schneiderin, nach dem Krieg wurde sie angesichts der vielen gefallenen Lehrer zur Volksschullehrerin ausgebildet. Das hat dem Unterricht aber nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Das Schulgebäude Schleidenstraße war noch teilweise zerstört und in dem verbleibenden Raum mussten alle Kinder aus der Gegend irgendwie untergebracht werden. Das führte zu Schichtunterricht und Klassenstärken von 35 Kindern pro Klasse (nur „Knaben“). In der Parallelklasse bei Fräulein Narbe, der schönen Junglehrerin und Schwarm aller Kinder, waren auch 35 Schüler. Sie hat dann bald den Lehrer Krüger (der mit dem Lloyd Alexander) geheiratet. Ich fand schnell neue Freunde und neue Hobbies. Da ich sehr bald gut lesen konnte, war ich Dauergast in der damals gerade neu eröffneten Bücherhalle in der Poppenhusenstraße. Es gab einen Leporello aus Pappe und da konnte man die Bücher eintragen, die man gelesen hatte. Es war mein Ehrgeiz, viel zu lesen und die Leporellos schnell (und immer ehrlich) zu füllen. Das ist mir dreimal gelungen. Einen Preis gab es nicht, aber ein großes Lob für den fleißigen Leser von den freundlichen Bibliothekarinnen.
In der zweiten Klasse hatten wir für einige Wochen einen Mitschüler, dessen Eltern als Schausteller davon lebten, Schimpansen in Käfigen auszustellen. Um ihrem Sohn, der sich ja permanent an neue Schulen gewöhnen musste, das Einleben etwas zu erleichtern, konnten alle jeweiligen Klassenkameraden immer kostenlos die Affen (ausgestellt auf einem planierten Ruinenfeld neben dem Barmbeker Bahnhof) besichtigen. Das war spannend, aber auch ein unendlich trauriges Elend. Auch im Abstand von so vielen Jahren frage ich mich: wer hat mehr Mitleid verdient, die Schausteller oder die Affen?
Der Mirowstraße gegenüber lag das Gymnasium Uhlenhorst-Barmbek und auf dem Schulhof konnte man mit dem Einverständnis des freundlichen Hausmeisters, Herrn Möller, prima Fußball spielen. Er war ein Dribbelkünstler, manchmal zeigte er für eine kurze Zeit seine Tricks. Es gab häufiger mal lautstarke Auseinandersetzungen zur Regelauslegung, aber eine Sache wurde strikt beachtet: der Eckenelfer! Pro drei Ecken gab es einen Elfmeter. Da der verfügbare Platz eher klein war, kam das ziemlich häufig vor. Mit steigendem Wohlstand hatten die ersten Mitspieler „richtige“ Fußballschuhe mit Stollen. Der Schuhwechsel wurde vor aller Augen angeberisch, bewusst langsam und sehr gravitätisch zelebriert. Durch diese „Wettbewerbsverzerrung“ auf dem Platz litt die Kameradschaft sehr. Da mein Talent für Fußball ohnehin sehr begrenzt war, verabschiedete ich mich irgendwann von dieser Truppe und aus der Welt des Fußballs.
Am Käthnerort standen noch zwei Ruinen. Es machte trotz strengstem Verbot viel Spaß, „Hausabreißen“ auf diesem unwiderstehlichen „Abenteuerspielplatz“ zu spielen. Niemand hat „gepetzt“ und alle hielten gegenseitig dicht – meine Mutter (not amused) hätte von diesen Aktivitäten nie erfahren, wenn mir nicht ein Ziegelstein auf einen Finger gefallen wäre. Der Finger musste operiert werden und die Narbe sieht man heute noch. Ich hatte, damals acht Jahre alt, allerdings gehofft, dass der Finger amputiert werden müsste. Denn dann, so glaubte ich, würden bestimmt alle denken, dass ich ein Pirat wäre. Heute sehe ich das etwas anders und bin froh, dass ich dank der Kunst der Ärzte den Finger noch habe.
Da wir keinen Fernseher hatten (er hätte in die kleine Wohnung auch nicht wirklich gepasst) ging ich gern zu meinen Großeltern in die Jarrestadt. Die hatten schon ein UKW-Radio und einen kleinen Schwarzweiß-Fernseher. Meine Lieblingssendung zum Schluss war „Einer Wird Gewinnen – EWG“ mit Hans-Joachim „Kuli“ Kulenkampff und mit deutschsprachigen Kandidaten aus vielen Ländern. Diese Sendung ließ ich nie aus. Es gab unter den Teilnehmern fast immer eine nette junge Französin oder Italienerin mit charmantem Akzent, und solche Teilnehmerinnen gefielen mir immer besonders gut (dem galanten Kuli übrigens auch). Mein Opa nahm mich am 1. Mai immer mit zur Maifeier der Gewerkschaften auf der Stadtparkwiese. Es ist unvergesslich, wie die riesigen Marschsäulen mit zehntausenden von Teilnehmern aus den verschiedenen Stadtteilen dort aufmarschierten, kein Vergleich mit heute.
Ich hatte etwas Angst vor solchen Menschenmassen, aber ich wusste, das mich mein Opa trotz seiner Kriegsverletzungen aus dem ersten Weltkrieg immer schützen würde.
Es gab auch noch Großeltern in Pinneberg. Die lebten dort in einem Behelfsheim, nachdem sie 1943 in Eimsbüttel ausgebombt wurden. Sie hielten einige Hühner und ich durfte bei unseren Besuchen die Hühner füttern und die frischen Eier aus den Nestern holen. Die Reise nach Pinneberg war damals eine kleine Weltreise im Dampfzug mit alten Abteilwagen. Die furchteinflößenden und mehr als mannshohen Stahlräder der Lokomotiven haben mich sehr beeindruckt. Man sah, auch am Barmbeker Bahnhof bei den Zugdurchfahrten auf der Güterumgehungsbahn, die Lokomotivführer und Heizer immer aus der Lokomotive schauen, so dass ich dachte, dass das Mitfahren und Rausgucken ihr Beruf wäre. Eine so schöne und entspannte Tätigkeit hätte ich mir auch für mich sehr gut vorstellen können. Wie die Lokomotive zum Laufen gebracht wurde, darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht.
Beide Großelternpaare sprachen miteinander und untereinander Hamburger Platt; mit den Kindern und Enkeln wurde aber ziemlich konsequent nur Hochdeutsch (mit einem Anflug von „Missingsch“) gesprochen. Das entsprach der damaliges herrschenden Auffassung, dass die Nachkommen es nur als Sprecher des Hochdeutschen „einmal im Leben besser haben können“. Nur vom Zuhören bei den Gesprächen der Großeltern habe ich Platt ein wenig gelernt. So kommt es, dass ich plattdeutsche Texte gut lesen kann und auch (fast) alles Gesprochene verstehe, beispielsweise im Ohnsorg-Theater oder bei den plattdeutschen Aufführungen der Amateurbühnen im Theater in der Marschnerstraße, die ich nach Möglichkeit nicht versäume. Meine Sprechkompetenz ist dagegen leider sehr beschränkt, da ich nie Gelegenheit hatte, mit den Großeltern Platt zu sprechen – das wurde sofort von allen Vieren abgeblockt. Wirklich sehr, sehr schade und nach dem Wissen von heute ein ganz großes Versäumnis. Aber es gibt ja leider wegen der eben skizzierten Sprachentwicklung auch kaum noch Gelegenheiten, das Plattschnacken zu praktizieren. Das zeigt exemplarisch das Schicksal kleinerer regionaler Minderheitensprachen: über ihren Fortbestand und ihr Überleben wird nicht an fremden Kabinettstischen entschieden, sondern ausschließlich im Rahmen der Familie am Küchentisch.
Mit meinem besten Schulfreund Manfred Lange, den ich nach dem Übergang aufs Gymnasium leider aus den Augen verloren habe, machte ich viele Radtouren und wir halfen dabei, mit etwas älteren Jugendlichen eine schöne große Radrennbahn aus Lehm und Sand am Mesterkamp zu bauen. Das war eine sehr schöne Freundschaft in den letzten drei Jahren der Kindheit. Wir waren praktisch jeden Tag mit unseren Rädern auf der Rennbahn. Später wurde dort der Bus-Betriebshof der HHA errichtet. Unser Lieblingsziel war aber der Barmbeker Stichkanal, um dort beim Entladen der Schuten für das Gaswerk zuzuschauen. Das war eine sehr schöne Freundschaft in den letzten drei Jahren der Kindheit.
Etwas, das mir zum Schluss noch einfällt: der je nach Empfinden penetrante oder angenehme Kaffeeduft, der (nach meiner Erinnerung alle 14 Tage) über Barmbek-Süd waberte, wenn bei Walter Messmer geröstet wurde. Ich habe Ihn nach so vielen Jahren irgendwie immer noch in der Nase.
1960 ist das Jahr, in dem meine Kindheit endete und, historisch betrachtet, unsere ganz persönliche Nachkriegszeit auch. Wir zogen nach all den Jahren um in eine größere Neubauwohnung in Barmbek (endlich mit Badewanne, Balkon, Kühlschrank, Waschmaschine, Zentralheizung, Einbauküche, Telefon, Musiktruhe – und einem eigenen Zimmer für mich!) um die sich meine Eltern lange bei der Genossenschaft bemüht hatten. Mein Vater bekam sein erstes Auto (ein VW-Käfer mit Vase am Armaturenbrett) und meine Mutter bekam ihre lang entbehrte elektrische Nähmaschine. Dafür gab es ja jetzt genügend Platz. Ich kam aufs Gymnasium (nur für Jungen, die Ko-Edukation wurde in Hamburg erst recht spät eingeführt) und hatte bald neue Freunde und neue Interessen. Wir machten unsere erste Auslandsreise mit dem Auto nach Dänemark und ich lernte dort schwimmen und Mundharmonika spielen.
Damit endet dieser Bericht, denn das wäre schon der Anfang für ein neues Kapitel.
Zu den beigefügten Fotos:
Mein Vater hatte schon seit den 1930er Jahren eine Kamera, hielt sich aber mit dem Fotografieren sehr zurück. Denn Filme und Filmentwicklung waren sehr teuer – da musste man sich bei jedem Motiv entscheiden und jede Aufnahme ganz genau überlegen. Das Foto von 1954 stammt von einem Wanderfotografen. Die waren damals recht zahlreich und versuchten auf diese Weise, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es wurden alle greifbaren Kinder fotografiert und etwas größere Kinder halfen dann gegen eine kleine Belöhnung beim Herausfinden der Adressen. Dann gingen die Fotografen von Tür zu Tür und boten die Kinderbilder den jeweiligen Eltern an. Das war (ähnlich wie bei den gelegentlichen Besuchen des laut seine Dienste anbietenden Scherenschleifers) ein sehr mühseliger Versuch, in der Nachkriegszeit etwas Geld zu verdienen. (Jedenfalls besser als die Tätigkeit des Drehorgelspielers, der regelmäßig in die Mirowstraße kam. Er hatte ein dressiertes bekleidetes Rhesusäffchen an einer dünnen Kette, das die aus den Fenstern geworfenen Münzen aufsammelte. Kein schöner Anblick! Meine Mutter, sonst immer gerne hilfsbereit, hat es immer abgelehnt, ihm etwas zu geben). Ich finde, dass der Wanderfotograf gut gearbeitet hat (das Original ist im Format DIN A 5). Etwas besser und wirtschaftlich gesicherter ging es den Schulfotografen. Die vereinbarten mit der Schulleitung die Fototermine, so dass sich alle darauf einstellen konnten. Die Datenschutzreligion hatte damals für Gruppenfotos glücklicherweise überhaupt noch keine Jünger*innen.
Prof. Dr. Holger Knudsen, São Paulo/Hamburg, November 2023
Barmbek Erinnerungen von Angelika Fassauer. ‘n echten Barmbeker Briet - was ich mal werden will
Eigentlich fing es alles sehr gut an: Meine Mutter hatte Urlaub und wir gingen zu C& A. In die ‚Hamburger Straße‘. Da stand es ziemlich einsam als einziges stehengebliebenes Haus. Mitten auf einer Wiese und eingekeilt von den zwei Fahrbahnen der langen Hamburger Straße. Ein ziemlich quadratischer Klotz aus rotem Backstein. Zwei Etagen, und in der oberen Etage war die Kinderbekleidung. Nachdem ich etliche Kleidchen anprobiert hatte, war meine Mutter endlich zufrieden: gelb mit weißen Rüschchen und einer Schleife auf dem Rücken. Nur für ‚gute Anlässe‘. Und dann kam die Begegnung, von der meine Mutter noch Jahre später erzählte: eine Dame kam auf uns zu, streichelte mir über das Haar und meinte: „Ach, das sieht aber niedlich aus!“

Wenn ich gross bin
Auf dem Nachhauseweg flüsterte meine Mutter ehrfurchtsvoll: „Weißt Du wer das war? Das war Ida Ehre. Eine ganz berühmte Schauspielerin. Nein, also dass die auch bei ‚Brenningmeyer‘ einkauft!“ Dazu muß man wissen, dass die ‚einfachen Leute‘ zu ‚C& A‘, und die ‚feineren Leute‘ zu ‚Brenningmeyer‘ gingen. Es war der gleiche Laden, klang aber gleich ganz anders!
Meine kurzen Beinchen waren zwar etwas müde als wir wieder im Langenrehm ankamen, aber es war erstens noch fast eine Stunde bis zum Mittagessen und außerdem waren Wolfgang, Sabine und Ute draußen. „Mutti, darf ich?“ Das war ein Wagnis, denn wir wollten gleich nach dem Essen zur Freundin meiner Mutter fahren und deshalb blieb ich noch ‚hübsch gemacht‘. „Sei aber vorsichtig, mach keine Flecken in das Kleid …“ und noch mehr Ermahnungen musste ich über mich ergehen lassen, bevor ich ‘runter durfte.“Was spielt ihr g‘rade?“ „Himmel und Hölle, aber das ist langweilig“ . Wie so oft fanden unsere Füße von ganz alleine zu dem einzigen Gebäude, das noch im Haferkamp stand. Ein ehemals weißer Flachbau mit einer Einfahrt hinter der sich kleine Werkstätten verbargen. Rechts von der Einfahrt war das Gebäude halb abgerundet. Geheimnisvoll und immer interessant. Vor allen Dingen weil es dort wohl einen Glaser (oder etwas ähnliches) gab. Jedenfalls lagen da oft kleine Verpackungsreste aus ganz leichtem Kunststoff auf dem Hof und damit konnte man herrlich an dem einzigen Fenster, das es an der Straßenseite gab, hin- und herreiben und dann quietschte es richtig ekelhaft. Und wenn dann auf dem Innenhof die Tür aufging, hatte man noch genügend Zeit zum weglaufen.
Weglaufen, stolpern, hinfallen, Kleid dreckig. Mensch, was hab‘ ich geheult. Die Wohnungstür war natürlich schon auf und meine Mutter stand dort mit entsetztem Gesicht in der Tür als ich endlich in der ersten Etage ankam. Für heute war da nichts mehr zu retten. Meine Mutter schlecht gelaunt und ich völlig zerknirscht, so machten wir uns auf den Weg zur Straßenbahn um nach Billbrook zu fahren. Dort hatte die Freundin meiner Mutter ein Haus in einer Schrebergartensiedlung und einen Sohn, Peter. Mit dem konnte man prima und verbotener Weise an und in dem kleinen Bächlein am Ende des Gartens spielen. Da gab es allerlei Getier und Schlamm bis zu den Knien. Das war toll! Fast so toll wie der Weg, den ich manchmal mit Oma und Opa ging. Die wohnten noch hinter dem Barmbeker Krankenhaus, im Prechtsweg. Von dort gingen wir oft zu Fuß zum Ohlsdorfer Friedhof. Aber da gab es nur nach Regengüssen große Pfützen mit Fröschen. Die Strecke hieß ‚schwarzer Weg‘ und so war er auch: Alles schwarze Erde und auf einer Seite eine hohe Hecke. Aber prima zum Frösche fangen … und zum Radfahren lernen! 
Beim Anleger des Alsterdampfers in der
Hufnerstraße 1959/60

Drosselstraße mit Blickrichtung
Bramfelder Straße/Alter Teichweg 1955
Auf dem Rückweg bekam ich manchmal aus dem kleinen Krämerladen, den es nur ein kurzes Stück vom Bramfelder See entfernt gab, ein kleines quadratisches Eis am Stiel. Die Meisen und die Eichhörnchen auf dem Friedhof, die verschiedenen bunten Enten auf dem See und ich, wir waren nach solchen Ausflügen bestimmt alle satt und zufrieden. „Wie seht ihr denn wieder aus!!??“ Schuh und Strümpfe aus, alles abgespült und dann mussten Peter und ich brav am Tisch sitzen bleiben. Zum Abschied gingen wir alle in den runden Bunker, der auf dem Gelände stand und jetzt als Aufbewahrungsort für das viele Eingemachte diente. In der Erinnerung sehe ich nur noch einen sehr schmalen, halbrunden Gang mit Regalen voller Gläser vor mir. Das war ein bischen unheimlich und ich war froh, als wir mit einigen Obstgläsern wieder in der Straßenbahn saßen.
Der nächste Tag war ein Sonntag und das war immer etwas langweilig. Die meisten Kinder mussten mit zu Besuchen und deshalb waren zu wenige unten, um ‚dritten Abschlag‘, ‚Fischer, Fischer wie tief ist das Wasser‘ oder andere Abzählreime zu spielen. Es blieb also nur ‚Geschichtenball‘, ‚Gummitwist‘ oder …. oder eine Inspektion des Grundstücks schräg gegenüber, an der Ecke Gerstenkamp / Langenrehm. Aber das war verboten. Da gab es nämlich Bauschutt und viele Kuhlen. Es war ein Trümmergrundstück und mit Stacheldraht eingezäunt. Der Einzige, der manchmal am Rand darauf durfte, war der Plakatkleber, der an der Außenwand des kleinen Werkstadthofs die großen Flächen beklebte. Meistens war das Zigarettenwerbung von Golddollar und Juno.

Blick auf den Daniel-Bartels-Hof
um 1950
Also, mal sehen ob man es ohne Schaden über den Stacheldraht schafft. Naja, so schlimm war das gar nicht. Aber es dauerte nicht lange bis irgendjemand rief: „Was macht ihr denn da? Wollt ihr da mal ‘runterkommen! Da dürft ihr nicht ‘rauf, das ist gefährlich!!“ Schnell weglaufen, hinfallen und den Fuß verstauchen. So schnell wie ich das alles geschafft habe war das wohl einmalig. Heulen gilt nicht. Und so biss ich die Zähne zusammen bis ich endlich – mit Hilfe von den Udo und Sabine – in der Wohnung angekommen war.
Als meine Mutter mit dem Schimpfen und Wehklagen fast fertig war, klingelten auch schon meine Großeltern an der Wohnungstür. Oma hatte den selbst gebackenen Kuchen und Opa die Glasschüssel mit der lose gekauften Schlagsahne in den Händen. „Ne,“ sagte mein Opa “ das ist nur verstaucht, nichts gebrochen. Fuß hochlegen und kalte Umschläge damit er abschwillt. In einer Woche ist er wieder wie neu. „Eine ganze Woche? Oh man, oh man.“
Immerhin blieb Opa bei mir sitzen während Mutti und Oma später in der Küche den Abwasch machten.
„Opa, warum sind da drüben so viel Schutt und so viele Löcher?“ „Da sind im Krieg Bomben gefallen und haben das Haus, das dort vorher stand, kaputt gemacht. Deshalb ist es dort auch so gefährlich. Es kann sein, dass es dort Bomben gibt, die nicht explodiert sind und wenn da ein kleiner Fuß drauf tritt, dann ist er nicht nur verstaucht, sondern ganz ab!“ „So wie bei dem Mann am Bahnhof?“ Unter der Brücke am Barmbeker Bahnhof saß nämlich oft ein Mann, der nur ein Bein hatte und dort auf einer ‚singenden Säge‘ spielte. Das klang fürchterlich schaurig und ich hatte großen Respekt vor ihm. Wir gingen oft in Richtung Bahnhof, zu dem Pferdeschlachter oder nebenan zu Faerber um Fische zu kaufen. „Ja, genau. Der hat sein Bein im Krieg verloren.“ „Ist Dir im Krieg auch ‘was schlimmes passiert, Opa? Was war das Schlimmste, was Dir passiert ist?“ Mein Großvater seufzte: „Ach Kind, das Schlimmste was ich erlebt habe ist anderen passiert.“ „Und was war das?“ „Ich weiß gar nicht ob ich Dir das erzählen soll? Doch, vielleicht ist das ganz gut so. Also: wir waren mit einer Gruppe Soldaten unterwegs Richtung Osten und haben auf viele Menschen aufgepasst: Sie wurden von uns bewacht und mussten vor uns her gehen. Es waren alles Juden. Ganz normale Menschen, die nur etwas anderes glaubten als die meisten von uns. Dann ließ unser Hauptmann den ganzen Trupp stoppen, die Juden bekamen Spaten und sie mussten eine riesige Grube ausheben. Danach sollten sie sich am Rand aufstellen und wir sollten sie erschießen. Die Grube sollte ihr Grab werden.“ Es vergingen einige Sekunden, die mir sehr lang vorkamen. „Ich habe aber nicht geschossen. Ich habe mich geweigert und es meinem Hauptmann auch gesagt.“ „Und die anderen Soldaten?“ „Die haben sich nicht geweigert.“ „Und dann?“
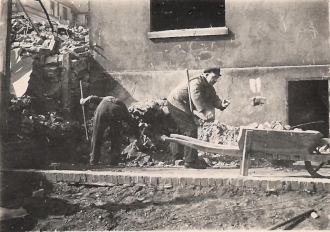
Bauarbeiten der Baugenossenschaft Hansa,
1950er Jahre
Meine Mutter und Oma unterbrachen das Gespräch: „Also wirklich. Musst Du Deiner kleinen Enkelin etwas so grausames erzählen? Sie ist doch noch ein Kind!“ Und zu mir gewandt sagte Oma: „Opa hat Glück gehabt, dass ihn ein sehr guter Freund zum Bunkerbau angefordert hat. Sonst würde es ihn heute auch nicht mehr geben.“ „Ach was,“ sagte Opa, „zu Anfang ging das noch, aber es hätten sich mehr weigern müssen. Viel mehr!“
Ich lag jetzt ziemlich eingeschüchtert auf dem Sofa und deshalb sagte Opa wohl zum aufmuntern: „Aber vielleicht darf dieser kleine Wildfang ja am Sonnabend mit zu Stahlbock!?“ Stahlbock, das war die kleine Kneipe an der Ecke Langenrehm / Gerstenkamp. Die hatten einen Fernseher und da wurde manchmal ‚in kleiner Runde‘ Ohnsorg Theater oder Fußball geguckt. Wenn es ‚Ohnsorg‘ gab, dann schimpfte meine Oma immer auf dem kurzen Weg bis zur Ecke, weil der ‘Komödienstadel‘ auf Bayrisch gesendet wurde und das ‚Ohnsorg‘ extra für‘s Fernsehen auf hochdeutsch spielen musste. Plattdeutsch war nun mal eine ‚ausländische Sprache‘ und Bayrisch nur eine Mundart! Aber Oma hatte Probleme mit dem Hochdeutschen, besonders mit dem ‚mir‘ und ‚mich‘. Im Plattdeutschen gab es für beides ja nur das ‚mi‘. Aber sie sagte immer: „Besser ‚mir‘ und ‚mich‘ verwechseln, als ‚mein‘ und ‚dein‘!“ Und damit hatte sie vollkommen recht!
Naja, aber bis Sonnabend waren es ja noch einige langweilige Tage ….
Am nächsten Tag musste meine Mutter wieder zur Arbeit. Ich wurde wieder auf das Sofa gelegt, mit einem Kissen und kalten Wickeln unter und um den geschundenen Fuß. Auf dem Tisch davor lagen Kinderbücher, belegte Brote, eine Wasserflasche und ein Apfel. Mit diversen Ermahnungen und guten Worten wurde ich alleine gelassen. Allerdings dauerte es nicht lange, bis sich ein Schlüssel in der Haustür drehte: Oma. Sie wollte noch mal ‘nach dem Rechten sehen‘ bevor sie in die Stadt fuhr. Und ich konnte nicht mit! Was Oma in der Stadt kaufen wollte, das wurde nicht verraten. Aber dass sie dieses Mal mit der Bahn fahren würde, das sagte sie mir. Das war wenigstens ein kleiner Trost, denn wenn sie wie üblich mit dem Alsterdampfer gefahren wäre, dann hätte ich bestimmt meinen Fuß vergessen und wäre mitgegangen.
Der Alsterdampfer war genauso teuer und genauso schnell am Jungfernstieg wie die Bahn, aber die Fahrt war wie Urlaub! Und der Anleger war ja nicht weit: Flachsland durch, an der klitzekleinen Post auf der rechten Seite vorbei, über die Brücke und am Anfang der Hufnerstraße, da wo es so schön nach Kaffee roch, da war der Anleger. An der Ecke gegenüber war die Behörde, zu der meine Mutter manchmal musste und die fand ich toll. Die hatten einen Paternoster mit dem man immer im Kreis fahren konnte. Aber das durfte ich nicht!
Oma tröstete mich ein bischen, rückte alles auf dem Tisch hin und her und ließ mich wieder alleine.
Ich ‚döste‘ etwas ein und träumte vom Winter. Wenn es kalt genug war und schön Schnee lag, dann ging Opa mit mir und dem Schlitten in den Eilbekpark. Es gab dort eine abschüssige Wiese, die eine fantastische Rutschbahn war. Nur leider floss an ihrem unteren Ende die Eilbek. Und auch wenn sie zugefroren war, bestand die Gefahr, dass man mit dem Schlitten dort einbrach und sich im eiskalten Wasser eine Erkältung holte. Die Lösung? Na klar: Opa. Der stellte sich unten hin und fing nicht nur mich, sondern auch alle anderen Kinder auf, bevor jemand im Bach landete. Unermüdlich!
Oma war schnell wieder zurück und ich wurde wach als die Wohnungstür aufging. „Vom Winter träumen? Das kommt ganz bestimmt von dem eiskalten Tüddel um deinen Fuß! Den machen wir schnell noch ‘mal neu und dann gibt‘s Mittag.“
Oma konnte nicht gut kochen, aber ihr Gurkensalat war ‘Spitze‘ und den gab es heute zum Nachtisch. Heute sogar mit Petersilie! Und dann wurden Heringe gebraten. Die hatte sie auf dem Weg bei ‚Faerber‘ am Bahnhof geholt und davon gab es heute einen warm aus der Pfanne mit Kartoffelmus und die restlichen wurden mit vielen Zwiebeln in sauer eingelegt. Es würde also eine ‚Heringswoche‘ werden. Auch gut. Ich mochte das. Schließlich kam das tolle Geschenk: zwei neue Kinderbücher mit vielen Bildern und etwas Text. Nächstes Jahr sollte ich in die Schule kommen, aber etwas konnte ich jetzt schon entziffern!

Blick auf die Häuser am Langenrehm
und den Daniel-Bartels-Hof um 1955

Fuhlsbüttler Straße nahe dem Barmbeker
Bahnhof, links Cafe König, Winter 1953 auf 1954
Und dann schwoll mein Fuß doch schneller ab als gedacht und am Freitag konnte ich wieder laufen. Glücklicherweise, denn das war ein großer Tag! Opa nahm mich mit in den Stadtpark und der war voller Menschen. Hauptsächlich Männer mit vielen Fahnen und die meisten waren Rot. „Oh,“ sagte ich, „so viele Leute. Das ist doch bestimmt eine Million!?“ „Na,“ lachte er, „so viele sind es dann doch nicht, aber hunderttausend, vielleicht sogar zweihunderttausend Arbeiter könnten es sein! Heute sind so viele hier, weil ein ganz großer Mann eine Rede hält. Einer von den Metallern: Otto Brenner.“ Ich saß bei Opa auf den Schultern und verstand kein Wort von der Rede. Auch den großen Mann habe ich nicht gesehen, aber das lag wohl daran dass wir ganz am Rand standen. Mit mir wollte Opa nicht in die große Menschenmenge auf der Stadtparkwiese gehen. Er sagte, dass es zu gefährlich sei, wenn eine Schlägerei angefangen werden sollte. Als alles zu Ende war, gingen wir zwar zum Ausgang aber nicht gleich den Wiesendamm runter. Wir überquerten die Straße und gingen in ein klitzekleines Häuschen aus rotem Backstein. Es stand mitten auf dem Bürgersteig und war eine Kneipe. Die war brechend voll und wir fanden kaum Platz, aber schließlich konnte mein Opa doch eine sichere Ecke für mich finden und ich bekam einen heißen Kakao. Der wurde mir schlückchenweise in die Untertasse gegossen, damit ich ihn schneller trinken konnte. Bis eine ganze volle Tasse Kakao abgekühlt war, konnten wir leider nicht warten, denn zu Hause dampfte bestimmt schon die Hühnersuppe auf dem Herd. Opa konnte alles gleichzeitig: sein Bier trinken, meinen Kakao immer wieder umfüllen und mit den anderen Arbeitern diskutieren. Wir wären wohl beide gerne noch etwas länger dort geblieben…
Zuhause angekommen musste ich den Fuß dann doch wieder hochlegen und etwas kühlen, aber das war für nur kurze Zeit nötig. Am Montag würde er wieder ‚wie neu‘ sein und deshalb nahm ich Opa auch das Versprechen ab, dass ich mit zu seiner Arbeit durfte. Dann bräuchte Oma auch nicht kommen um auf mich auf zu passen.
Opa war Maurer und hatte auch das Haus gebaut, in dem wir jetzt wohnten. Das fand ich toll und dafür bewunderte ich ihn. Aber Dieter, der immer etwas zu meckern hatte, sagte dass es gar nicht stimmt. Neben der Haustür war eine Tafel eingemauert und auf der stand ‚aufgebaut‘ und deshalb, so sagte Dieter, hat er das Haus nicht gebaut sondern nur wieder aufgebaut. Aber ich konnte ja schon ein bischen lesen und deshalb wusste ich, dass er nicht Recht hatte. Auf der Tafel stand in Wirklichkeit nämlich ‘avgebavt‘! Ich wusste zwar nicht, was das heißen sollte, aber am Montag würde ich Opa bestimmt endlich ‘mal danach fragen.

Bauarbeiten Barmbeker Strasse
Das Wochenende verging unheimlich schnell. Und dann war es endlich Montag. Ich kriegte meine Manchesterhose an und eine zusammengeklappte und in Butterbrotpapier eingewickelte Scheibe Leberwurstbrot wurde in die Tasche des Brustlatzes meiner Hose gesteckt. Heute war die ‚Abholtour‘ dran, sonst hätte ich auch nicht mit gedurft. Opa und Herbert, sein Kollege holten mich mit dem Pritschenwagen ab und ich durfte zwischen Ihnen in der Fahrerkabine sitzen. Wir fuhren Material für die neue Baustelle holen und bei ‚Krüger und Scharnbek‘ oder ‚Möller und Förster‘ kannten sie mich schon und alle waren freundlich. Heute wurden wieder viele von den roten Klinkersteinen geladen. Da waren immer mehrere mit Draht zu einem Stapel zusammengebunden. Und weil ich unbedingt mithelfen wollte, wurden diese Drähte für mich durchgekniffen und ich konnte die Steine einzeln zum Wagen tragen und auf die Pritsche legen. Die konnte ich mal eben so erreichen und so war das eine ziemliche Herausforderung, aber es war toll! In der Pause saßen wir zu Dritt im Wagen und aßen unser Brot. Herbert und Opa tranken Kaffee aus der Thermoskanne und ich bekam eine kleine Flasche ‚Sinalco‘. Als Opa mich dann wieder zuhause ablieferte, lief ich schnell nach oben und gleich geradewegs zum Balkon um noch ‘mal zu winken. Sehen konnte ich ihn zwar nicht, aber ich konnte rufen und meine winkende Hand war etwas über der Brüstung zu sehen. Aber dann stockte ich, denn ich hörte wie Herbert zu meinem Opa sagte: „Deine Lütte, die wird auch ‘mal so‘n richtiger Barmbeker Briet!“ und Opa lachte und erwiderte: „Das kann wohl sein. Wäre nicht das Schlechteste!“ Ich stoppte im Lauf, holte ganz tief Luft und kriegte große Augen. „Mutti, ich weiß, was ich später‚ mal werden will!“ „Und was ist das?“ „Ich will ‘n echten Barmbeker Briet werden!“
Angelika Fassauer, 2020
Barmbek Erinnerungen von Peter Kindt. Lehrzeit bei Kampnagel
Ende 1953 Anfang 1954 ging mein Vater mit mir auf die Suche nach einer Lehrstelle. Das war zu der Zeit gar nicht so leicht. Einerseits wollte er nicht, dass ich bei der Bahn lernen sollte und andererseits auch nicht auf den Werften. So fragten wir bei den Betrieben in Barmbek an. Carl Später und andere hatten nur Lehrstellen für Schweißer oder ähnliches, das war meinem Vater nicht genug. Bei Kampnagel wurden wir fündig. Ich bekam eine Stelle als Stahlbauschlosser. Das fand er gut, da Kampnagel eine große Firma war und ich später sicher Vorarbeiter oder auch Werkmeister dort werden könnte. Leider erlebte er den Beginn meiner Lehrzeit nicht mehr. Für mich begann wieder eine völlig neue Welt.

Das Kampnagel Werksgelände, der Kran
in der Mitte war ein Probeaufbau einer Serie
von Hafenkränen für Chittagong
Meine Lehrzeit bei Kampnagel
Ich verdiente zum ersten Mal regelmäßig Geld, denn mein Lehrgeld betrug 45 DM. Im 2. und 3. Lehrjahr stieg das Lehrgeld über 55 auf 65 DM. Außerdem war es damals noch möglich als Lehrling im 3. Lehrjahr im Akkord zu arbeiten und auch Überstunden zu leisten. Das waren willkommene Gelegenheiten um sein Geld aufzufrischen. Später kam ein neues Jugendschutzgesetz raus, dann ging das alles nicht mehr.
Kampnagel war eine alte Hamburger Firma und stellte im Hauptgeschäft Hafenkräne, Werftkräne, Hüttenkräne und Schiffskräne her. Nebenprodukte waren Rolltreppen, Paternoster, Reismühlen und Shat-Davits. Angesiedelt war sie in der Jarrestadt am Osterbek-Kanal.
Es arbeiteten ca. 1500 Leute, davon ca. 400 in der Verwaltung, Arbeitsvorbereitung und im Konstruktionsbüro. Dann waren wir ca. 250 Lehrlinge, der Rest waren die Facharbeiter der verschiedensten Fachrichtungen. Es wurde bis auf die Motoren alles selber hergestellt. Dafür gab es eine Gießerei, eine Härterei, eine Dreherei, Fräserei, Hobelei. Eine Schmiede, Schweißerei, Brennerei, Nieterei und vor allem die Stahlbauabteilung in der Osthalle, sowie noch andere Werkstätten. Ausgehend von der Lehrwerkstatt mussten wir alle diese Fachabteilungen als Lehrling durchlaufen bis wir dann endlich in die Montagehalle zum Zusammenbau der Elemente kamen.
Zur Firma kam ich entweder mit dem Fahrrad (im Sommer immer, im Winter meistens), oder mit der S-Bahn bis Barmbek und dann zu Fuß ca. 20 Minuten. Die Arbeitszeit war 48 Stunden in der Woche. Der Arbeitsbeginn war 7.00 Uhr und Schluss war 16.00 Uhr mit einer halben Stunde Pause. Am Samstag arbeiteten wir von 7.00 Uhr bis 12.30 Uhr. Im dritten Lehrjahr waren wir auch noch scharf auf Überstunden oder Akkordarbeit, um ein wenig mehr Geld zu verdienen. Urlaub hatten wir 2 Wochen.
Am Anfang und Ende der Arbeitszeit mussten wir an der Stempeluhr stempeln. Außerdem wurden diese Zeiten und die Mittagspause mit Hörnern angekündigt. Umgezogen wurde sich in riesigen Umkleideräumen mit großen Gemeinschaftsduschen. Jeder hatte seinen Spind. Die Arbeitskleidung bekamen wir vom Werk geliehen gegen ein winziges Entgelt. Dort wurde sie auch gewaschen und geflickt. Werkzeug und Lederhandschuhe wurden gestellt. Die Werkzeugkiste bauten wir in der Lehrwerkstatt selber.
Essen konnten wir preiswert in der Betriebskantine. Es gab immer so etwas wie Eintopf, mal mit mal ohne Fleisch. Wir Lehrlinge hatten natürlich immer einen gewaltigen Hunger, sodass wir meistens die ersten in der Kantine waren. Das allein schon deswegen, weil wir dann noch die Chance auf einen Nachschlag hatten. Wenn man schnell genug aß, schaffte man auch zweimal einen Nachschlag. Hier lernte ich das schnelle Essen, das ich Zeit meines Lebens nie wieder los wurde. Übrigens machte meine Mutter mir jeden Morgen einen Haferbrei, weil ich ja so dünn war.

In der Lehrwerktstt
In den ersten 6 Monaten waren wir in der Lehrwerkstatt. Hier lernten wir die Grundfertigkeiten, wie feilen, bohren, meißeln, schaben, sägen usw.. Der Lehrmeister hieß Kulp und war gleichzeitig noch Meister in der Werkzeugmacherei. Der Lehrgeselle hieß Albrecht, er war völlig haarlos. Deswegen ging er immer 15 Minuten vor Feierabend zum Duschen und Umziehen. Er war hart, aber gerecht. An drei Lehrkollegen erinnere ich mich: Adrian von Saucken, er war nebenher quasi Manager einer Jazzband, Ottmar Ludwig, er war aus einer etwas mehr betuchten Familie, denn er spielte Hockey in einem reichen Club, dem HTHC, und Klaus Gesinski, er kam erst spät aus Russland zurück, dorthin wurde er mit seiner Familie nach dem Krieg verschleppt. Wir machten natürlich auch Unfug. So spielten wir mit den Pappschachteln, in denen Schrauben waren, Fußball. Das hatte ein Ende, als wir in eine Schachtel einen Eisenklotz legten, und sich ein Kollege beim Fußball damit die Zehen brach. Eine der schönsten Arbeiten war der Bau der eigenen Werkzeugkiste aus Blech. Außerdem stellten wir Lehrstücke her, wie Schraubenschlüssel, Außentaster, Innentaster u.a.. Diese Teile habe ich bis heute aufgehoben.
Anschließend ging es für 2 Monate in die Lehrschweißerei. Hier lernten wir E-Schweißen, Autogenes Schweißen und löten. Besonders schwierig war das Schweißen mit „blanken“ Elektroden, weil diese immer am Blech festklebten. Aber wenn man das gelernt hatte, konnte man mit allen anderen Elektroden auch schweißen. Unfug machten wir auch hier. Wir füllten leere Milchtüten mit Wasserstoff- und Sauerstoffgas, steckten einen Strohhalm rein und zündeten ihn an. Die Explosion hörte man in der ganzen Halle und verbog manchesmal die seitlichen Bleche der Schweißbox. Gefährlich war es, in die Schweißflamme ohne Schutzschild zu sehen, das führte zum „Augen verblitzen“. Das tat weh und man sah eine ganze Weile schlecht, so dass man auch krankgeschrieben wurde. Gott sei Dank hatte ich Glück und hatte das Übel auch später in der Werkstatt nie.
Nun ging es richtig los, wir kamen in die Produktion, denn es ging nur noch zweimal in die Lehrwerkstatt – im 2. Lehrjahr zu einer Art Zwischenprüfung und am Ende des 3. Lehrjahres zur Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung.

Besprechung mit Lehrgeselle Albrecht
Es fing an in der Kolonne, in der die Ausleger und Kranhäuser zusammengebaut wurden. Hier war ich einem Altgesellen zugeordnet, der nur plattdeutsch sprach. Er brachte mir die Grundzüge des Zusammenbauens der einzelnen Blech- und Trägerteile zu einem Ganzen bei. Die Hauptwerkzeuge waren ein 5 kg Hammer und der Schweißbrenner zum Richten. Er gab mir zum Schluss auch schon kleine Teile, die ich selber bearbeiten konnte. Von ihm lernte ich auch eine Weisheit, nämlich, dass ich nicht nur mit „ja, ja“ antworten sollte, denn das bedeutet „leck mich am Arsch“. Er hat recht. Die Sprache war überwiegend Plattdeutsch, wie auch in den anderen Kolonnen.
In einer weiteren Kolonne wurden Paternosterkörbe und Greifer hergestellt. Dort war der Beginn die langweiligste Arbeit, die ich je hatte – 3 Wochen lang mit einer Tellerschleifmaschine die Führungsrahmen von Paternosterkörben blank schleifen. Damals waren die Lehrlinge dafür gut genug. Aber dann durfte ich Greifer zusammenbauen. Die Kolonne war klein, aber dort machte es Spaß, weil der Vorarbeiter eine Seele von Mensch war.
Darauf folgte die Brennerei. Hier wurden die angezeichneten Bleche oder anderen Teile mit Schweißbrennern auf die richtige Form getrennt. Die Arbeit war nicht gerade langweilig, aber teilweise diffizil, da man immer den Brenner richtig einstellen musste, sonst konnte ein Brennschnitt ganz schnell unbrauchbar werden.
Die nächsten drei Monate waren gemütlich. Erst Maschinenarbeit in der Hobelei, und dann im Reismühlenbau. Dort lernten wir den Umgang mit dünnen Blechen.

Die Kolone der Schmiede
Der härteste Job war dann in der Schmiede. Es wurden z. B. Flachstähle von 5 x 10 cm in Ringe für Zahnkränze geformt. Dazu wurden sie glühend gemacht und dann mit Hebeln auf einer großen Lochplatte gebogen. Den Gesellen machte es Spaß, uns Lehrlingen an dem Hebel möglichst dicht an das glühenden Eisen zu bringen. Dort fiel einem fast die Haut vom Gesicht, das Eisen hatte immerhin mehrere 100 Grad. Wir lernten aber auch richtig schmieden mit Hammer und Amboss.
Dann folgten weitere 17 Wochen im eigentlichen Stahlbau. Eine Zeitlang davon war ich im Shat-David-Bau (die Kräne für die Rettungsboote großer Schiffe). Der Vorarbeiter Büchel war ein Ekel. Z. B. machte er sich ein Spaß daraus, seine Pfeife mit Pressluft zu Putzen und dabei ganz beiläufig den stinkenden Dreck auf unsere Anzüge zu spritzen. Als mein Lehrkollege mal etwas länger weg war, lief Büchel hinterher und fand ihn auf dem WC, das keine abschließbare Tür hatte. Wutentbrannt brüllte er: „Sitzt der doch auf dem Klo und liest Zeitung. Wenn er doch wenigstens die Hose runtergezogen hätte.“ Hier zog ich mir meine einzig nennenswerte Verletzung zu. Ich schlug eine Buchse in ein Lager mit einem 5 kg Hammer. Dabei kam der Hammer etwas aus dem Weg, und ich haute mir mit voller Wucht auf den Daumen. Gott sei Dank blieb der Knochen heil, aber ich wurde 6 Tage krankgeschrieben.
Anschließend wurde es ruhiger, denn ich ging für 13 Wochen in die Lehrwerkstatt zur werksinternen Zwischenprüfung.

In der Anreißerei in der Osthalle
Danach kam ich in die Anreißerei. Dieser Teil machte mir am meisten Spaß, denn einerseits waren die Kollegen in der Kolonne sehr angenehm und andererseits kam mir, die Arbeit als mathematisch und zeichnerisch Begabter sehr entgegen. Hier wurden die Einzelnen Bleche und Formstähle vorbereitet zum Brennen, Bohren und Schweißen, d. h. es mussten die Zeichnungen auf die Stähle übertragen werden. Erst musste ich die Kleinteile anzeichnen. Aber der Vorarbeiter merkte bald, dass mir das Geschäft lag, und ich durfte ihm bei dem Anzeichnen der großen Bleche assistieren. Ich stellte mich dabei so gut an, dass er, als er sich eines Tages verletzte, weil ich ihm ein paar Winkel versehentlich auf die Finger geworfen hatte, so dass er krankgeschrieben wurde, mir seine Vertretung übertrug. Sein Stellvertreter war sehr enttäuscht, denn er dachte sofort, dass er nun die großen Bleche machen durfte. Zu seiner und meiner Überraschung sagte der Vorarbeiter jedoch, ich war im 3. Lehrjahr: „Nein, nein, die macht der Peter“. Eine große Ehre für mich.
Jetzt gab es nur noch eine Station, die mir viel brachte, nämlich die Arbeit im Technischen Büro. Hier wird die Arbeit in der Werkstatt vorbereitet. D. h. man bekommt die Konstruktionszeichnungen und muss daraus die Einzelteile herausziehen und zu Schablonen und Handrissen verarbeiten, die dann in der Anreißerei weiter verarbeitet wurden. Dafür musste man gut Zeichnungen lesen können und auch gut rechnen und zeichnen können. Ich erledigte auch dort meine Arbeit zur vollen Zufriedenheit des Vorgesetzten.

Schluss in der Lehrwerkstatt
Am Ende der Lehrzeit waren wir wieder in der Lehrwerkstatt zur Vorbereitung auf die Prüfung. Wir bauten nochmals die Prüfungsstücke der vergangenen Jahre nach und übten alle schwierigen Dinge. Ich baute mir dabei einen kleinen Schraubstock, den ich selber entworfen hatte und dessen Zeichnung ich zu Hause gefertigt hatte.
So vorbereitet ging ich in die Prüfung. Sowohl die schriftliche als auch die praktische Prüfung bestand ich mit „sehr gut“. Mehr noch, ich war der Jahrgangsbeste der Stahlbauschlosser von Hamburg. Den Gesellenbrief erhielten wir in einer Feier der Industrie- und Handelskammer überreicht. Zum Schluss gab es dann noch eine interne Abschlussfeier bei Kampnagel. Als Belohnung für mein gutes Ergebnis durfte ich mir von Kampnagel ein Buch wünschen. Ich entschied mich, da ich zwischenzeitlich die Aufnahmeprüfung der Staatsbauschule Hamburg bestanden hatte, für die drei Bände von „Schreyers Baustatik“. Damit endete meine Lehrzeit.

Direktor Dr. Spangenberg und
Lehrmeister Kulp überreichen mir einen Preis
Peter Kindt, 2018
Barmbek Erinnerungen von Günter Sohnemann. Weihnachtsstrapse
Endlich die Kirche war aus. Ich, Günter, fast 8 Jahre alt, hab die ganze Zeit in der Kirche gelitten. Das Datum damals: Weihnachten, den 24.12.1948.
Vor eintausendneunhundertachtundvierzig Jahren war der Befreier und Menschenfreund in der Krippe gelegen. Ein Baby, nichts dolles, war ich doch auch mal, so sind wir doch alle einmal angefangen, um in das Leben zu gehen.
Toll, dass es für seine Geburt Geschenke gibt, auf die alle Kinder der Welt ungeduldig warten. In der festlich geschmückten Kirche, mit zwei Tannenbäumen und elektrischen Kerzen behangen, verfolgte ich nicht das Geschehen des Gottesdienstes. Meine Gedanken waren schon lange zu Hause in der guten Stube, mit dem Weihnachtsbaum der unter den zwölf Wachskerzen und der Lamettalast stöhnte.
In den schmalen Lamettastreifen spiegelte sich das Licht der brennenden Wachskerzen, als kleine glitzernde Blitze. Die zwölf Kerzen brachten ein warmes Licht in die weihnachtliche Stube. In Gedanken sah ich einen roten Tretroller unter dem Weihnachtsbaum und viele kleine Matchboxautos. Bunte Päckchen und Pakete für mich und meine Geschwister. Ich wollte sie gerade öffnen, als mich ein leichter Knuff in die Seite in das Hier und Jetzt zurückbrachte.
Der Gesang der Gemeinde war verstummt. Im Mittelgang des Gotteshauses waren die Kirchengänger dabei, sich unter weihnachtlicher Orgelmusik langsam und von der frohen Botschaft erfüllt, zu dem Ausgang der Kirche zu bewegen. Auf dem Kirchvorplatz sammelten sich kleine Grüppchen der Gemeinde, um sich gegenseitig ein „gesegnetes Weihnachtsfest&qout; bei Nieselregen zu wünschen.
Ich träumte mir einen Winter zum Heiligabend. Mir war sehr kalt, ein erster leiser Schneefall setzte ein. Die Schneeflocken blieben auf den Hüten, Mützen und auf den Schultern der Kirchenbesucher liegen. Auch die schwach brennenden Barmbeker Gaslaternen setzten sich die weißen Mützen des Winters auf. Die Linden am Straßenrand mit ihrem schwarzen Geäst boten dem leisen fallenden Schnee Asyl auf ihren gefrorenen Zweigen. Mein Traum endete. Es war um die blaue Stunde, ich nahm es wahr im Nieselregen. Viel Gemurmel unter den Kirchenbesuchern. „Wollten die denn nicht nach Hause gehen, zu ihrem Weihnachtsbaum und den Geschenken?“, dachte ich. Ich zerrte ungeduldig an den Ärmeln meiner Eltern. Ich wollte nach Hause, zu den Geschenken, ja auch zu dem Weihnachtsbaum.
Endlich ja, endlich machte sich unser Familientross auf den Heimweg, durch die kühle, frostige, beginnende Abenddämmerung. Die nasse Kälte kroch mir die bestrumpften Beine hoch, bis unter meine kurze Hose. Dort biss sie mich gemein, in das der Kälte ausgesetzte Stück des Oberschenkels. Zwischen den langen Strümpfen unter meiner kurzen Hose. Dort schützte mich nichts vor der nassen Kälte, außer ein paar dünnen Strapsen, die von einem Leibchen gehalten die Strümpfe am Runterrutschen hinderten. Auf dem Heimweg hatte meine Schwester Gertrud die Idee, in den wenigen bewohnten Häusern Barmbeks, zwischen den Ruinen, die beleuchteten Weihnachtsbäume zu zählen. Das war ja wie eine Schatzsuche, an dem nasskalten Abend draußen das Licht in den Fenstern, der wärmenden Kerzen an den Weihnachtsbäumen zu zählen. Dabei vergaß ich die Kälte, die mich zwickte.
Bis nach Hause zählte ich achtzehn Weihnachtsbäume mit ihren brennenden Wachskerzen hinter den Gardinen der Fenster, wo mit Sicherheit die Familien schon bei der Bescherung waren. Ich als Kind dachte nur, die haben es gut, die haben ihre Zeit nicht in der Kirche verbracht. Ich sehnte mich in die gute Stube zu unseren Geschenken unter dem Weihnachtsbaum.
In der ausgekühlten Wohnung angekommen, wurde erstmal in der Küche, um den ovalen, schon mit den unterschiedlichsten Porzellantellern und Bestecken gedeckten Tische Platz genommen. Wir, ich und meine Familie, waren ausgebombt worden. Das größte unterschiedliche Porzellansamelsurium der Familiengeschichte hatten wir. Heute kann ich erzählen, dass dieses Porzellan noch gute Dienste, auf Polterabenden in der Wirtschaft-Wunderzeit machte.
Während Oma den kalt gewordenen Küchenofen anheizte. Und Opa es geheimnisvoll mit dem Stubenofen in der Weihnachtsstube tat.
Dann wurde eine riesige Schüssel mit Kartoffelsalat in die Mitte des Tisches gestellt. Bald brannten im Küchenofen auch die Briketts. Eine große Menge Wiener Würstchen wurde in das heiße Wasser, welches in einem Topf auf dem Küchenofen stand, gelegt. Als die Würstchen dampfend in einer Schüssel neben einem Korb Brötchen auf dem Tisch standen, holte Opa noch schnell ein Glas Mostrich aus der Speisekammer.
Es war wieder warm geworden in der Küche.
Opa sprach noch ein kurzes Dank-Tischgebet für die guten Gaben. Ich vergaß für einen Moment die Weihnachtsgeschenke. Würstchen satt, hatte ich noch nie in meinem Leben gegessen. Ich habe, glaube ich heute sagen zu können, drei Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen, lecker und die guten Brötchen.
Endlich eine Ewigkeit war vergangen seit der Kirchenzeit. Die Erwachsenen verschwanden alle in der Weihnachtsstube, um etwas vorzubereiten, wie sie sagten.
Erst beim Läuten der Glocke sollten wir, ich und mein kleiner Bruder, die Tür aufmachen und in die Weihnachtsstube kommen. Meine Gedanken waren: Die haben die Weihnachtsglocke verlegt, jetzt suchen sie diese.
Unser durch die geschlossene Tür Fragen, ob wir die Glocke überhört hätten, wurde mit einem, „noch einen Augenblick“, beantwortet. Endlich der silberne Klang eines Glöckleins ertönte. Andachtsvoll drückte ich die Klinke der Weihnachtsstubentür herunter. Die sich nun öffnende Tür lief uns in eine von gedämpftem Licht erfüllte, warme Stube schauen.
Da saßen Oma, Opa, Mama, Papa, Gertrud, Martha und Hermann mit feierlich angestrahlten Gesichtern. Die Lichtquelle, der Weihnachtsbaum mit seinen brennenden Wachskerzen stand in der Ecke hinter der Tür. Diesen sahen wir erst, als wir ganz in die Stube traten.
So feierlich die Großen auch waren, uns, die beiden kleinen Kinder interessierte das nicht. Uns interessierten nur die Pakete unter dem Weihnachtsbaum. Mein Tagtraum in der Kirche war nicht in Erfüllung gegangen, das sah ich auf den ersten Blick. Kein Ballon-Tretroller, aber ein Kran mit vier Rädern mit weitem Ausleger und Kurbel zum rauf und runterlassen der Lasten, war dabei.
Ein energisches „Halt erst ein Weihnachtsgedicht aufsagen!““, kam von den Erwachsenen auf dem Sofa. Unsere großen Schwestern Gertrud und Martha hatten mit uns je ein Gedicht eingeübt. Meins hatte ich schon wieder vergessen, aber mein Bruder Gerhard sagte brav “ Drauß‘ vom Walde komm ich her“ auf. Mein Gedicht brachte ich nur mit Hilfe meiner Schwester Gertrud zu Ende. Endlich durften wir an die Geschenke.
Der Kran war von Opa im Keller mit vielen kleinen Nieten auf einem Stück Hamburger U-Bahnschiene als Amboss zusammen genietet worden. Eine alte Nähgarnrolle mit einer Kurbel, voll mit Paketband aufgerollt, war die Seiltrommel des Kranhakens. Mit grauer Farbe angestrichen, wurde es mein Lieblingsspielzeug.
Der dazu gehörende hölzerne LKW auch grau angemalt. Dann kam der Satz von Oma : „Aber den Kran und den LKW, müsst ihr Euch teilen.“ Die anderen Geschenke zum Anziehen interessierten mich nicht mehr. Ich wollte nur das Spielzeug. Oma und meine Mutter machten mich darauf aufmerksam, da lägen noch mehr Weihnachtsgeschenke unter dem Tannenbaum für mich. Erst mit ihrer energischen Hilfe wurde mir die selbstgestrickte, hässliche braun-weiße Pudelmütze mit Bommel aufgesetzt. Dann kam ein gruseliges Teil, von Oma ausgepackt. Mit warmen Worten wollten sie mir das Praktische eines Leibchens erklären.
Ich hasste und hasse diese Leibchen für Jungen bis auf den heutigen Tag. Der Tag der Befreiung nahte, einen Monat später, Ende Januar. Da hatte ich Geburtstag und bekam meine erste, lange Hose. Eine sogenannte Skihose, mit Bündchen zum Zuknöpfen am Unterschenkel am Knöchel. Diese Weihnachten ging in meine Erinnerung ein. Als frostige Weihnachten, als Weihnachtsstrapsen-Weihnacht 1948
Günter Sohnemann,26.12.2015
Barmbek Erinnerungen notiert von Wolfgang Wunstorf. Frühling mit 7 am Rübenkamp (1961)
Die schwergängige Haustür stemmt er nur ein wenig auf, gerade weit genug, um sich aus dem dunklen Treppenhaus ins Freie zu winden. Hinter ihm liegt eine flinke Abfahrt am Treppengeländer aus dem 3. Stockwerk, so schnell und gewandt, wie es wohl kein anderer Siebenjähriger im ganzen Mietsblock vom Rübenkamp 80 a-c fertig bringen könnte. Er beherrscht das meisterhaft. Den angewinkelten Arm über den polierten Handlauf eingehängt, einen Fuß abstoßbereit gegen die Stufenkante gestemmt, noch einmal ruhig durchatmen, die Stille im Treppenhaus prüfen, und wenn die alten vergilbten Wände ihm dann aufmunternd zunicken, geht es schwungvoll hinunter bis zur ersten Wende. Die Richtungswechsel zwischen den Stockwerken verlangen besonderes Geschick, damit alle Bewegungen bis zum Parterre im Fluss bleiben.

Geländer im Rübenkamp
Heute hat er sicher eine Bestzeit erzielt. Niemand war ihm unterwegs begegnet, der zu grüßen gewesen wäre und damit die Rekordfahrt verdorben hätte. Es ging rasant durch alle Etagen, und sein schnellster Pullover garantierte wie schon so oft höchstes Tempo. Der blaugraue Pulli zeigte nicht mehr viel her, an den Ellenbogen war er schon mehrmals von der Oma gestopft worden, aber kein anderes Kleidungsstück glitt so wunderbar auf dem hölzernen Handlauf. Ganz sicher wäre er heute Sieger geworden, hätte sich ein Herausforderer mit ihm messen wollen, soviel stand fest. Also nahm sich Winfried etwas von dem stolzen Gefühl, das für die Gewinner bestimmt ist. Das Treppenhaus freute sich still mit ihm, er konnte es spüren. Nun entlässt es ihn in einen frischen und hellen Apriltag und wartet mit der Duldsamkeit betagter Gemäuer auf seine Rückkehr.
Er trabt zu der großen Linde auf dem Platz vor dem Haus, einem der beiden wichtigsten Treffpunkte aller Kinder der umliegenden Mietsblöcke. Tagsüber bietet der Platz eine freie Spielfläche. Die Mädchen spielen dort Geschichtenball und Gummitwist, die Jungen Fußball oder Messersteck, und alle zusammen spielen Kriegen, Verstecken oder Kippelkappel, eines der schönsten Spiele überhaupt. Erst abends parken dort einige Väter ihre Autos. Ein Opel Olympia, ein DKW und der graue Goliat der Nachbarn stehen dann dort. Auch Winfrieds Vater stellt jeden Tag nach der Rückkehr aus dem Büro seinen Wagen auf dem Lindenplatz ab. Vor zwei Wochen war er mit der neuen Arabella nach Hause gekommen. Alle haben sie bestaunt. Kein Vergleich mit dem Lloyd 600 zuvor, da war man sich einig.


Die Ladenzeile
Winfried guckt sich am Lindenplatz und vor den Läden um, aber von den Spielkollegen zeigt sich niemand. Vielleicht liegt es daran, dass noch Mittagszeit ist. Er blickt suchend den Grögersweg bis zur Schule Fraenkelstraße herunter, er geht dort in die erste Klasse, bummelt dann zwischen Laden und Linde hin und her, sieht durch das Schaufenster des Milchmanns auf die große Uhr hinter dem Tresen, erwägt und verwirft den Gedanken, Uwe herauszuklingeln – seine Mutter lässt ihn immer deutlich merken, dass das mittags störend ist – und beginnt ein wenig zu frösteln. Die Aprilsonne kann erst am Nachmittag den Lindenplatz bescheinen, jetzt ist es dort noch schattig und kühl. Winfried steckt die Hände in die Taschen seiner Lederhose, fühlt die 20 Pfennig vom letzten Taschengeld und die Glasmarmeln, die er sich vorhin eingesteckt hat.

Schulgebäude

Winfried schaut den Plattenweg entlang, der von seiner Haustür 80 c bis zum Rübenkamp führt, doch im Augenblick ist kein Mitspieler zu finden. Er lässt sich vom alten Dahlheim Salmis für 10 Pfennig abwiegen und geht mit der gefüllten Spitztüte in der Hand zum Lindenplatz zurück. Einige Salmis presst er mit der Zunge unter den Gaumen, wo sie sich langsam auflösen. Der Tüteninhalt wird bis zum Nachmittag reichen.
Mit Schlenderschritt nun zu Milchmann Willing ans Fenster, zuschauen, wie er Butter auf Vorrat abpackt. Klack klack, die hölzernen Spatel stechen und schlagen zackig die abgewogenen Butterportionen in Form, ruckzuck sind sie eingewickelt und aufgestapelt. Dabei die Augenbrauen gewichtig hochziehen und Erklärungen aller Art abgeben, ja, Herr Willing weiß Bescheid, und dass mag er den Hausfrauen auch zeigen. Seine Frau lächelt dazu und bedient die Kunden. Solange ihr Mann im Laden zu tun hat, sagt sie kaum etwas.
Jetzt kommt Frau Malchow vom zweiten Stock mit gefüllter Einkaufstasche aus dem Laden, wie immer mit ihrem Hütchen auf dem leicht geneigten Kopf. Im Gehen lächelt sie zu Winfried herüber. Er mag sie gern und schaut ihr nach, bis sie im Hauseingang verschwindet. Die Feder auf ihrem Hütchen wippt mit jedem Schritt.
Noch einmal zurück zum Lindenplatz. Zusammen mit dem Baum auf andere Kinder warten. Wieder Salmis an den Gaumen kleben. Schuhband ist auf. Neue Schleife binden. Erster Versuch ist nichts geworden, also nochmal. Salmitüte in die Tasche stecken. Mal eine Marmel vor das Auge halten: wie wird der bunte Farbstreifen im Innern wohl gemacht?

Gerdi grinst. „Wollen wir …?“ Schlagartig ist Winnfried von begeisterter Erregung erfüllt. Der große Gerdi will ein tolles Spiel machen und nimmt ihn, den so deutlich jüngeren, als vollwertigen Partner an. Von der Partie würde man auf den Straßen tagelang sprechen. Habt ihr gehört, Gerdi und Winni haben um einen Riesenpott gespielt, ja, wirklich! Und Winni hat gewonnen. Oder verloren. Egal, darauf kommt es nun gar nicht an. Natürlich könnte die Partie verloren gehen, es ist sogar wahrscheinlich. Das wäre dann tapfer wegzustecken, dem wäre man gewachsen. Und habt ihr das gehört? Winni hat ohne zu zucken bezahlt. Ja, der hat Format!
Um dreißig also. Abgemacht! Gleich kann’s losgehen. Nur eben schnell hoch und Marmeln nachholen. Bin gleich wieder da.
Im Laufschritt zur Haustür, rein ins Treppenhaus, hallo, ihr Stufen, da bin ich schon wieder, hab’ was tolles vor, eine Riesenpartie, muss jetzt im höchsten Tempo nach oben, klingeln, Mama, mach auf, muss schnell Marmeln holen, Gerdi spielt mit mir um dreißig, jawohl, staune nur, das wird ne spannende Sache, kannst mir Glück wünschen, und wenn ich doch verlier, ist’s nicht weiter schlimm. Jetzt nur schnell sein, Gerdi wartet unten auf mich – was für ein Tag!
Die Mutter schält Kartoffeln und schaut nur kurz auf. Sie hat ihre Sorgen, die er nicht kennen kann und ist heute unerreichbar für seine Begeisterung. „Nein, ich will nicht, dass Du das spielst.“ Ratscht, das Messer fährt durch eine Kartoffel, die Hälften plumpsen ins Wasser. Die Ablehnung ist endgültig.
Aus. Zerschnitten die Freude mit einem Satz. Der Schreck friert den Bauch ein, danach bohrt stille Verzweiflung. Und unten wartet Gerdi, oder nein: der ganze Frühling wartet auf Winfried. Er soll doch spielen, wagen und wachsen. Eine kleine senkrechte Falte zwischen den Augenbrauen setzt sich fest und will nicht mehr verschwinden.
Was nun zu Gerdi sagen? Das Treppenhaus fühlt Winfrieds geknickten Schritt, den zusammengezogenen Blick und kann ihn doch nicht aufhellen. Das einladend glänzende Geländer bleibt unbeachtet. Winfried beugt sich über die Brüstung und schaut durch den breiten Mittelspalt des Geländers in die Tiefe bis zum gefliesten Boden im Erdgeschoss. Ganz ruhig hält er den Kopf, holt tief Luft und nimmt Maß. Dann lässt er einen Klacks Spucke runtertropfen. Und wenn der schnurgerade fällt, nicht am Geländer hängen bleibt und vollständig unten ankommt, dann – er überlegt kurz die Wette – ja, dann wird er eines Tages der netten Silke vom Nebenhaus nahe sein können. Vielleicht schon vor dem Winter. Während die Spucke fällt, halten die alten Wände bereitwillig still. Wenn es nach ihnen geht, so soll es glücken. Und verpetzen werden sie ihn auch nicht.
Ein leises, aber deutlich vernehmbares „klatsch“ aus dem Parterre verkündet den Erfolg seines Wettspiels. Dann dreht Winfried sich um, klingelt ohne viel nachzudenken noch einmal an der Haustür, murmelt zur Mutter etwas von „Ball aus dem Zimmer holen“, stopft dort ganz still beide Hosentaschen mit Marmeln voll, hält sich den Ball vor den Bauch und verlässt rasch die Wohnung. Hängt seinen Arm über den Handlauf und startet eine gleichmäßige Rutschpartie bis zum ersten Treppenabsatz. Das Geländer spürt, dass er an Gewicht gewonnen hat seit der Abfahrt vorhin. Und das liegt nicht nur an den Marmeln in den Taschen. Wagen und wachsen. Gerdi, gleich kann’s losgehen!
Wolfgang Wunstorf, 2018
Barmbek Erinnerungen notiert von Peter Kindt. Juli 1943 Bombenangriffe und Evakuierung
Aufgewachsen bin ich in Barmbek in der Starstraße 20 in einem Arbeiterviertel. Die Häuser waren ca. 5 Stockwerke hoch und hatten im Wesentlichen kleine 1- und 2-Zimmer-Wohnungen. Gebaut wurden sie in den 1920er Jahren. Meine Erinnerungen an den Juli 1943 sind nur bruchstückhaft. Teilweise habe ich sie erlebt, so wie es ein 6-jähriger kann, teilweise beruhen sie auf Erzählungen von Verwandten oder ich habe sie nachgelesen. Viele Kinder wurden durch die Angriffe traumatisiert. Das hielt sich bei mir in Grenzen.

Die Starstraße
Die Bombenangriffe auf Barmbek
Im Haus waren Kellerräume notdürftig als Bunker ausgebaut. Auch wurden die Keller der Nachbarhäuser durch Durchbrüche verbunden. Zusätzliche Abstützungen wurden eingebaut. Einfache mehrstöckige Betten waren die Ausrüstung und jede Familie hatte ein Notpaket dabei. Immer wenn die Sirenen gingen, mussten wir runter in den Keller und bis zur Entwarnung warten.
Ab 1941 fielen auf Barmbek immer wieder Bomben und es gab Luftalarme. Ich erinnere mich besonders an eine Luftmine, die 1942 in der Nähe runterging, und zwar am Tieloh. Es war eine gewaltige Bombe, die enormen Schaden anrichtete. Da wackelte auch unser Haus recht bedenklich und wir im Keller hatten Angst, dass etwas zusammenbricht.
Mein Vater ging einmal mit mir nach einem Angriff nach Wandsbek, um mit mir die Zerstörungen anzusehen. Wir gingen durch brennende Straßen.

Vater von Herrn Kindt mit Sprößling
Die schweren Angriffe kamen im Sommer 1943 mit der „Operation Gomorrha“. Sie zielten nur auf Arbeiterviertel, um die Produktionskapazität zu verringern und um die Bevölkerung zu demoralisieren. Bei den ersten zwei Wellen sahen wir die Lichterbäume am Himmel, die Strahlenbündel der Flakscheinwerfer und das Brummen der Bomber. Den Höllenlärm der Detonationen der Bomben hörten wir nicht so sehr, denn wir waren dann ja im Keller. Bei dem zweiten Großangriff auf Hamm, mit dem vernichtenden Feuersturm am 28. Juli 1943 (ca. 30.000 Tote), kam meine Tante Alma Brinkopp mit ihrem jüngsten Sohn um. Nur der Vater Karl und Sohn Walter überlebten. Es war für die Verwandten seltsam, wieso er ohne seine Familie aus dem Keller kam.
Die dritte Welle traf Barmbek in der Nacht 29./30. Juli 1943. Es flogen 726 Bomber an. Sie warfen 400 Luftminen,
5 000 Sprengbomben, 900 000 Stabbrandbomben, 1200 Phosphor-Kanister und 450 Flüssigbrandbomben ab. Danach brannte Barmbek auf einer Fläche von 6 Quadratkilometer. 75 % aller Gebäude wurden zerstört, der Rest schwer bis leicht beschädigt.
Die Evakuierung
Es zeigte sich, dass die vorhandenen Bunker und Schutzräume völlig unzureichend waren. Daher wurde eine Evakuierung eingeleitet, die in einigen Stadtteilen, beispielsweise bei uns in Barmbek, noch rechtzeitig durchgeführt werden konnte. Alle Bewohner, die nicht unbedingt in der Rüstungsproduktion benötigt wurden, mussten die Stadt verlassen. Die meisten Kinder wurden im Rahmen der Kinderlandverschickung auf dem Land in Sicherheit gebracht. Insgesamt flohen nach den Angriffen etwa 900 000 Hamburger aus der Stadt in das Umland oder in die Aufnahmegaue in Bayern und Ostdeutschland bzw. Polen. Meine Eltern hörten von der Evakuierung nicht offiziell, sondern von einem Nachbarn, einem Polizisten, der sagte, dass es besser wäre zu flüchten. Am 28. Juli abends müsste die ganze Bevölkerung draußen sein. Wir packten das notwendigste auf einen kleinen Blockwagen, den wir uns geliehen hatten, und zogen los, wie fast alle anderen (ca. 120 000 Menschen). Wir zogen zu Fuß bis Hoisbüttel
(ca. 13 km) und fanden dort eine Feldscheune. Diese war allerdings voller Flaksplitter, weil in der Nähe einer Flakstellung war, so dass mein Vater mit uns weiterzog bis zu einem Gasthof in Hoisbüttel. Der hatte seine Scheune schon für die Flüchtenden freigemacht. Von dort sahen wir, wie Barmbek brannte. Der dadurch ausgelöste Sog war sturmartig zu spüren. Mein Vater ging am nächsten Morgen noch einmal zurück, um eventuell noch Sachen zu holen – aber es war sinnlos.

Trümmer in der Fuhlsbüttler Straße
Vier alleinstehende Frauen in unserem Haus blieben im Keller. Sie hatten Glück, dass ein beherzter Nachbar sie in der Pause zwischen Spreng- und Brandbomben rausholte, indem er den Durchgang vom Nachbarhaus her aufmachte, denn der Hauseingang bei uns war schon verschüttet. Wie es weiterging, habe ich nicht mehr ganz in Erinnerung. Aber wie mir meine Schwester erzählte, wurden wir an einem Morgen von LKWs abgeholt und auf die Bahn nach Ahrensburg zur Evakuierung gebracht. Der Güterzug fuhr los Richtung Osten, Ziel für uns unbekannt. Die Güterwagen waren überfüllt und stickig, so dass die Männer die Waggontür aufmachten und sich davorlegten, damit wir Kinder nicht aus Versehen rausfielen.
In der Nacht hielt der Zug auf einem Bahnhof. Mein Vater erkannte, dass es Wittenberge war, in der Nähe seines Geburtsortes Bälow. Kurz entschlossen verließen wir unerlaubt den Zug und nahmen noch ein paar Nachbarn mit, um nach Bälow zu gehen. Mein Vater telefonierte mit einem Schulkameraden, der den einzigen PKW mit Anhänger in Bälow hatte. Der brachte uns am nächsten Morgen nach Bälow. Dort wurden wir von Verwandten aufgenommen.
Doch der Bürgermeister (BM) wollte unsere Aufnahme verweigern. Doch mein sonst ruhiger Vater rastete in diesem Augenblick wohl aus und schrie den BM an, dass seine Familie wohl doch in seinem Geburtsort bei seiner Familie aufgenommen werden kann und muss. Der BM lenkte ein.
Eine Nachwirkung der Bombennächte gab es bei mir, die ich aber erst später merkte: Ich habe eine große Angst vor offenem Feuer, sei es Lagerfeuer, zu denen ich immer mit Respekt Abstand hielt. Ich kann zündeln nicht leiden, habe auch nie gezündelt, und vor allem, ich kann brennende Kerzen auf dem Weihnachtsbaum nicht ausstehen, weil ich dabei in ständiger Angst lebe, dass der Baum zu brennen anfangen könnte. Auch Tischkerzen fallen darunter.
Im Gegensatz dazu kann ich mich nicht erinnern, dass ich während der Bombenzeit Angst gehabt hätte. Als Kind nimmt man solche Geschehnisse wohl unbefangener wahr, man findet sie einfach abenteuerlich.
Peter Kindt, 2017
Barmbek Erinnerungen notiert von Friedrich Schnoor "Vörspruch to dat 27 (30) jährig Stiftungsfest
Diesen Vortrag hat mein Vater 1929 und 1932 mit leichten Änderungen gehalten vun`n Vereen „De Plattdütschen“ vun 1902 to Hamborg (Vereenslokol Fründ Rudolf Hauenschildt „Sentahalle“) verfoot vun Friedrich Schnoor
O scheune Tied, wenn Lenz de Knospen weckt,
So fien opbleuht wie lebendige Gedanken.
Wenn mit Gesang de Wannerburschen treckt,
In Feld un Goorn de lütten Blomen ranken.
Wenn Smetterlinge ehre Flünken streckt,
Vun Tweig to Tweig de lütten Vagels sweewten.
Wenn alls Farw un Duft un Melodie,
Insmeichelnde- Musik un Poesie.
Doch nu de wiede Heben grau in grau,
Bald Winterfrost, denn wedder Regenschuur,
De Wannervagel fleet den`n nord`schen grau`,
Un heuchstens singt een Vagel noch in`n Buur.
As Seltenheit een Stückchen Hebenblau,
Dat dröge Loow verwelkt in stumme Truur.
Vun Licht un Farw un Duft ok nich een Spoor,
Dor singt allöberall keen Vagelschor.
Un doch sünd hier veel froh Gesichter
Wenn buten ok de Winter störmen deiht.
De scheune wiede Festruum strohlt vun Lichter,
Un öberall sünd sünd Minschen, de sick freit.
Dat drängt sick in den`n Sool hier dicht un dichter
De Oogen glänzt för helle Fröhlichkeit.
All de wi swöört hebbt op de plattdütsch Fohn,
Wi doht jo hüt uns Stiftungsfest begohn.
Vör 27(30) Johr is`t west, in`n Februor
(In „Eilbeck“ weerd, vör söbenuntwindig Johr,)
Dor keum`n wi „Plattdütschen“ toers tosoom.
Un weer ok lütt man doormols noch de Schoor,
Se meuken Ehr` doch ehrn plattdütschen Noom`n.
Keen Arbeit vörn Vereen weer ehr to swoor,
Un so wüß van uns` „Eek“, uns plattdütsch Boom.
So wör se stark dörch Leew un Fliet un Meuh
Uns Vereen „De Plattdütschen vun 1902“.
Doch vun Bestand is nicks op düsse Eer.
Un ok wi Plattdütschen dehn dit erleben.
Et keum een Tied, un de weer bös un swoor;
De Krieg harr uns All uteenanner dreben.
Vun den`n Vereen, dor bleew ok gornicks mehr.
In frömde Eer is Mancher vun uns` bleben.!-
As wi trüchkeum`n no uns Woderkant
Hebbt frisch wi unsen Eekboom wedder plannt.
Is se ok stark nich, as se freuher weer,
So lot wi uns de Meuh doch nich verdreeten.
För uns Eek stoht wi as Plegers dor,
Mit unsen` Haddbloot dot wi se begeeten.
Dat bald se greun`n mög as in freuher Johr
Un wi mit Stolz uns „De Plattdütschen“ köönt heeten.
As wi de Olln streewt wi för unse Sook,
För unse Heimoot (uns Vereen) un unse Moodersprook!
Un hüt hebbt wi uns nu tosoomenfun`n
Hier in de „Sentahall“, mit unse leewen Doom`n.
Üm to verleben`n poor vergneugte Stün`n.
Uns`Stiftungsfest to fiern, sünd wi hier koom`n.
Dat plattdütsch Wort, dat geiht vun Mund to Mun`n,
Et hett jo holln uns ümmer noch tosoom`n.
So wölt ok hüt uns Modersprok wi ehrn,
Bi Vürdrag un Musik uns amüseern.
Willkom`n denn Ji Alltosoom`n loot uns nich rohn,
Treckt ok op`d Nee`e wedder kräfdig an,
Een Kraft mutt dorch de anner wiedergoon,
Nich alls alleen kann jo de enkelt Mann.
Dat wat wi köönt, dat möt wi ümmer dohn,
Een Jeder deiht soveel he irgend kann.
De Arbeit sie een Lust uns, nie een Last!
Wat ok mag koom`n:
Plattdütsche Jungs un Deerns;
„Holt fast, Holt fast, Holt fast!“
Friedrich Schnoor, 1902
geb.1879 – gest.1966

Barmbek Erinnerungen notiert von Friedrich Schnoor
Herr Schnoor schickte uns ein weiteres Gedicht seines Vaters in dem die Sentahalle in Barmbek erwähnt ist und das im Moment gut in die Zeit passt.
Der Flieder blüht!- An Hecken und an Wegen
Sehn wir ihn steh’n in seiner vollen Pracht
Allüberall leuchtet er uns entgegen
So frisch und bunt, daß uns das Herze lacht
Nun wird zu eng es uns in unserem Hause
Der Flieder blüht, da ziehen wir hinaus
Wir fahren mit der Bahn weit in die Ferne,
Im Rucksack Eier, Butterbrot und Wurst,
Nach Poppenbüttel, Quellental und Berne,
und komm’n wir dort an, haben wir schon Durst,
im ersten Wirtshaus kehren wir gleich ein,
oh kinners wat is de Natur so scheun!
Hier wird nun erstmal kräftig ein gehoben,
denn solche Bahnfahrt strengt auch an,
wir trinken hier, da müssen wir uns loben,
nicht Schnaps und Bier, nein heut bloß Fliedertee.
Doch dieser Tee, der schmeckt verdammt nach Spriet,
mir ist als wenn er in die Beine zieht.
Doch nun wirds Zeit, jetzt müssen wir auch laufen
wir wollen erfreuen uns an der Natur
wir wollten uns ja nur auch mal verschnaufen
und vorwärts geht es nun durch Wald und Flur.
Der Flieder blüht, wir riechen mal daran,
und jeder klaut soviel er tragen kann,
ja schön ists in der Fleiderzeit zu wandern,
denn wo im Dorf nen Krug man wird gewahr,
da schieben wir rein einer hinterm andern,
der Flieder ist so schwer das ist doch klar.
Mit leerem Portemonnaie kom wir nach Haus.
Doch was macht uns das? – Wir haben ja einen Fliederstrauß.
Doch warum immer in die Ferne schweifen,
wo doch das gute liegt so gar nicht weit.
Wir brauchen nicht im Quellental rumzustreifen
und können spar’n viel an Geld und Zeit
denn wie es jeder hier heute abend sieht,
in der Sentahalle auch der Flieder blüht.
Es sind hier heut geladen Freund und Gäste,
von unserem Wirt und dem plattdeutschen Verein,
dass sich hier alle auf dem Fliederfeste
bei Tanz und Vortrag sollen mal erfreuen.
Un de sien Modersprook noch god versteiht,
de weet ook gliek: hier herrscht Gemütlichkeit.
un nun roop ik Jug to denn Alltosoomen,
de hier vereinigt in de Sentahall
vun ganze hadden sünd uns hüt willkoomen!
Recht veel vergneugen wünscht wi jug nu all!
Denn unse Wirtslüüd geewen sick veel Möh.
Un wölt ji duhn warrn, bestellt man Fleedertee.
Friedrich Schnoor, 1902
geb.1879 – gest.1966
Barmbek Erinnerungen notiert von Günter Sohnemann "Die Kristallnacht" - erlebt und erzählt von Heinrich T.
Die Pose zuckte, rüttelte: Da, jetzt der Biss, die Pose verschwand im naturtrüben Alsterwasser in die Tiefe. Der Anschlag mit der Angelrute folgte. „Nichts!“ Heinrich T. war enttäuscht. Diesmal war ihm sicherlich ein großer Brasse entkommen. „Schade!“ Heinrich T. saß schon lange auf dem blechernden, alten, umgedrehten Marmeladeneimer, mit seiner Angelrute aus Bambus, an der Buchtstrasse am Löschplatz am Wasserviereck, welches durch einen kurzen Kanal mit dem Wasser der Außenalster verbunden ist. Hin und wieder wurde die Stille durch Klingeln, Rumpeln und Quietschen der Straßenbahnen gestört, wenn sie vom Mundsburger Damm in die Buchtstrasse abbogen, um nach kurzem Halt, Richtung Lange Reihe zum Hauptbahnhof weiter zu fahren, oder umgekehrt vom Hauptbahnhof kommend bis zur Mundsburger Brücke fuhren.
Auf der Mundsburger Brücke gab es eine Weiche. Sie wurde vom Straßenbahnfahrer, der direkt auf der Brücke anhielt, bedient. Dafür musste er sich weit aus seinem Fahrstand lehnen, Um mit einer Eisenstange die draußen am Fahrstand hing, die Weiche zu stellen, je nachdem in welche Richtung die Straßenbahn fahren musste. Heinrich T. hörte schon gar nicht mehr das Quetschen und Rumpeln der Räder der Bahn. Seine Gedanken waren weit weg, er hatte Hunger, zu Hause warteten die Geschwister auf einen leckeren Fisch aus der Alster. Brassen und Rotaugen hatten zwar viele Gräten, aber das Fleisch dieser Fische war sehr schmackhaft und lecker. Gerade dann besonders, wenn man wie er auch am Hunger litt.
So trieben seine Gedanken in die Gegenwart, in eine Zeit, in der „ER“ lebte. Dieser Hitler seine Braunhemden, diese Kommunisten, diese politischen Strömungen, die mit ihrem Hass, mit Feindbildern und Parolen das ganze Volk vergifteten.
All das stank ihm zum Himmel, dass der Hitler Hilfspolizisten ernannt hatte, die nie den tiefen Teller erfunden hätten. Die haben nun das sagen und die Macht. Diese 16jährigen treten alten Leuten in den Hintern, wenn diese um leiseres Absingen von Marschliedern nachts um 24 Uhr bitten. Die alkoholisierten, jungen Hilfspolizisten halten jeden Einspruch gleich als Widerstand gegen ihren Führer. Das gehört ausgemerzt. Fanatisch wird jeder bekämpft und angezeigt. Ja, es geht die Angst um bei den Menschen, die nicht für den Maler, Tapezierer und Gefreiten sind. Die Macht dieser Hilfspolizisten ist groß und die Angst unter der Bevölkerung ist es auch, Die Juden sind in akuter Lebensgefahr, nichts ist deutlicher als das NSDAP- Programm.
So laufen Heinrichs Gedanken durch den Kopf. Im Geiste hört er die SA- Horden grölen, als er einen neuen Wurm auf seinen Haken zieht, mit lässigem und gekonnten Schwung wirft er seinen Köder gezielt an die Stelle, wo er einen Biss hatte. Dann setzt er sich auf seinen mitgebrachten Blecheimer um auf den nächsten Biss zu warten und seinen Gedanken nach zuhängen. Immer noch hört er lärmenden SA-Horden. Hassparolen gegen die Juden klingen durch die Luft. Es sind, das merkt er schnell, nicht seine Gedanken im Kopf, die den bekannten Lärm erzeugen. Nein es kommen immer mehr Stimmen mit lautem Gebrüll näher. Er dreht sich um und sieht schon viele Braunhemden vor den Häuser wohlhabender Juden in der Buchtstrasse in die Stadthäuser eindringen. Aus dem Mundsburger Damm kommt um die Ecke noch eine im Gleichschritt marschierende und Nazilieder ab singende Gruppe. Was folgt: Kommandos, Schreie, Lachen und Gläser klirren. Ein Hagel von Steinen, begleitet von Hassparolen fliegt in die Fenster. Bei irgendwelchen Zerstörungserfolgen jubelt die Menge grölend laut auf. Heinrich T. kann es nicht ertragen. Seine Wut über die Dummheit der Massen und seine eigene Machtlosigkeit machen ihn traurig.
Er dreht sich zurück zu seiner Angel. Auf einmal kommen die Stimmen der Braunhemden näher, schon fliegen Mäntel, Wäsche, Stühle und sogar eine Kommode mit lautem Hallo und Jubel links und rechts von Heinrich T. ins Wasser. In einer Pause hatten wir wiederum einen netten Small-Talk, und er konnte sich wohl nicht mehr an mich, aber doch noch an den Auftritt im historischen Jazz-Keller in Neuburg erinnern. Es war wieder ein unvergesslicher Abend!
Nun platzt es aus ihm heraus und er brüllt ohne Überlegung: „Was soll das denn?“ Schlagartig war es still. Der Anführer der SA baut sich vor ihm auf. Mit einem gefährlichen Unterton in der Stimme, fragte er Heinrich T.: „Was soll was? Hast Du was dagegen? Hast du was gegen uns?“ Die Gruppe rückte immer näher der Kreis wurde immer enger. Da rettet Heinrich, was man heute emotionale Intelligenz nennt, aus dieser gefährlichen Situation. Mit lachender Stimme sagte er: „Nee, nee ich hab nichts gegen Euch. Aber ihr verjagt mir die Fische, wenn ihr alles neben meiner Angel in die Alster werft!“ „Oh wir verjagen ihm die Fische, der Arme!“ So entspannte sich für Heinrich die Situation. Der Anführer der SA brüllte an seine Leute einen kurzen Befehl: „An die Arbeit, Männer!“ Die Gruppe der Braunhemden verschwand grölend über die Straße, um in den Häusern der Juden ihr Zerstörungswerk zu vollenden. Heinrich T. packte seine Angel, nahm seinen alten Marmeladeneimer und war erleichtert davon gekommen zu sein. Er zog hinüber zur Schwanenwik, um dort in der Alster sein Anglerglück zu versuchen.
Heinrich T. hatte nach dem zweiten Weltkrieg eine Bosch-Auto-Elektrik-Werkstatt im Holsteinischen Kamp unter den Hochbahnkasematten. Sein Sohn Manfred J. führte das Unternehmen weiter, als Heinrich T. in den Ruhestand ging. Heinrich T. ließ es sich nicht nehmen, jeden Tag in den Betrieb zu kommen und sich irgendwie nützlich zu machen. Ich wartete auf mein repariertes Auto und er vertrieb sich die Zeit, mir aus seinem Erleben und Überleben des 1000jährigen Reiches zu erzählen. So bin ich zur obigen Geschichte gekommen. Beiden, Vater und Sohn, zeichnete eine Unaufgeregtheit und Gelassenheit in besonders schwierigen Situationen aus. Möge das von nachfolgenden Generationen auch zu sagen und zu schreiben sein. Das wünsche ich von ganzem Herzen meinem Jugendfreund und seiner Familie Manfred J.
Barmbek Erinnerungen von Kai Krause Barmbeker Jung und der Jazz
Das Barmbeker Leben findet zwar – zugegeben – in Barmbek statt, doch das bedeutet nun noch lange nicht, dass jeder Barmbeker Jung‘, jede Barmbeker Deern auch den Rest des Lebens in Barmbek zu verbringen hat, quasi bis zum bitteren Ende. Ohne dass ich mir damals dessen bewußt wurde, gab es doch einen Anlass, der dafür sorgte, dass ich mich mehr für die große weite Welt interessierte. Mein gleichaltriger Lehrkollege Ernst Hänsgen schleppte mich nach Feierabend an einem Donnerstag zur Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark. Bisher hatte ich mich sehr für klassische Musik interessiert,jedoch dieses hier erste erlebte Jazzkonzert hat mich derart begeistert, dass mein Freund und Kollege Ernst zukünftig nicht mehr alleine dorthin gehen mußte. Donnerstags war einfach Jazz angesagt. Es war eine wunderbare Atmosphäre: man lauschte der Life-Musik, unterhielt sich aber nebenbei auch zwanglos und trank sein Alsterwasser. Hier und da wurde zwischen den Bänken auch ein Tänzchen gewagt.

Eines Donnerstags war „Papa Bues Viking Jazzband“ angesagt. Hatte ich noch nie gehört. Allein der kleine „Papa Bue“, ca. 1,60 Meter dänischer Nationalstolz, war mit seiner Posaune schon sehenswert.
Er muß damals um die 30 Jahre alt gewesen sein und galt in Jazzmusiker-Kreisen bereits alt „alter Mann“, daher die Bezeichnung „Papa“, so wurde mir erklärt. Ich durfte für 50 Pfennig Eintrittgeld 2 Stunden Jazzmusik vom Allerfeinsten genießen, war mir damals aber nicht darüber im Klaren, dass ich eine Legende erleben durfte. Nach meiner Lehrzeit wurde ich Monteuer im Kraftwerksbereich und installierte 10 Jahre lang Wärmetauscher in fast allen bundesdeutschen Kraftwerks-Neubauten. Irgendwann blieb ich dabei in Bayern hängen und verbrachte in Neuburg an der Donau ebenfalls fast 30 Jahre meines Lebens. Hier entdeckte ich einen kleinen, aber feinen Jazz-Club, welcher nach mehrjähriger Pause gerade wiederbelebt und durch seine Konzerte mit Spitzenmusikern schnell im Umkreis bekannt wurde. 1991 konnte der Club den Gewölbekeller der alten Hofapotheke für sich gewinnen, und ich durfte bei der Renovierung und dem Umbau zum Jazz-Keller dabei sein. Inzwischen ist dieser Jazz-Club mit seiner einmaligen Räumlichkeit einer der beliebtesten in Deutschland geworden, und das gilt auch für die auftretenden Musiker. Eines Samstag-Abends große Überraschung: wer steht auf der Bühne? Mein großer Freund Papa Bue mit seiner Viking Jazz-Band! Ein Wiedersehen nach über 30 Jahren. In der Pause tranken wir zusammen am Tresen ein Bier, und er erinnerte sich noch gut an den Auftritt im Hamburger Stadtpark. Es war ein unvergesslicher Abend, und diesesmal war ich mir durchaus bewußt, mit einer Jazz-Legende „Skal“ sagen zu dürfen.

Aber nun, lieber Leser, ist die Geschichte ja noch nicht fertig erzählt. Ein paar Jahre später unternahmen meine Ewa und ich eine Motorradtour über Mecklenburg, Rügen, setzten mit der Fähre über nach Bornholm, und fuhren von dort nach Kopenhagen, um uns ein paar Tage bei der Kusine meiner Frau schadlos zu halten. Nun waren wir schon einmal in Kopenhagen, und wenn man ein paar Tage Zeit hat, dann gehört ein Besuch des „Tivoli“ einfach dazu. Während wir also zusammen durch diesen wirklich schönen und interessanten Amüsierpark pilgerten, klangen plötzlich von Ferne Jazz-Klänge in mein geschultes Ohr. Ohne darüber zu diskutieren schlugen wir die Richtung ein, aus der diese Musik kam. Wer steht auf der Bühne: mein großer (kleiner) Freund Papa Bue, inzwischen über 70 Jahre alt, mit seiner weltberühmten Viking Jazz-Band, und er blies nach wie vor alle seine vorhandene Atemluft in die Posaune, um ihr wunderschöne weiche Klänge zu entlocken. In einer Pause hatten wir wiederum einen netten Small-Talk, und er konnte sich wohl nicht mehr an mich, aber doch noch an den Auftritt im historischen Jazz-Keller in Neuburg erinnern. Es war wieder ein unvergesslicher Abend! Anno 2011 hat Papa Bue uns Freunde der Jazzmusik im Alter von 81 Jahren verlassen. Ich habe alle Alben von ihm, und er wird immer einen Platz in meinem Herzen behalten.
Und dieses erzähle ich dem Forum der Barmbeker Geschichtenwerkstatt, weil ein Barmbeker eben nicht alle seine Abenteuer nur in Barmbek erleben kann. Manchmal muß man auch äber den Tellerrand hinausschauen, und auch wenn ich heute in Polen lebe, so bleibe ich doch ein „Barmbeker Jung“ !
Kay Krause am 12. März 2017
Barmbek Erinnerungen von Ernst Broers. H&H, das Ende einer Barmbeker Traditionsfirma. Eine literarische Erzählung. (Namen und Orte sind frei erfunden)
In aller Stille hatte ein folgenschweres Ereignis stattgefunden: Die Firma Zunftherr hatte einen Interessenten für das Fabrikgelände in der City gefunden: Ein großes Kaufhaus wollte das zentral gelegene Grundstück kaufen. Man einigte sich über den Preis, die Stadtverwaltung stellte ein neues Grundstück am Rande der Stadt,“auf der grünen Wiese“, zu äußerst günstigen Bedingungen zur Verfügung und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze gab es einen Kredit zu Niedrigstzinsen und einen großzügigen Zuschuss. Die Firma Zunftherr konnte bauen, sich vergrößern. Endlich!
Dass dafür in einer anderen Stadt mehr Arbeitsplätze verschwinden als Zunftherr in dieser Stadt neu schafft, das interessiert doch keinen Kommunalpolitiker.
Im Zweigwerk Hartmann kam wieder einmal der Herr Aufsichtsratsvorsitzende Bartelmeier zu Besuch. Sogar eine außerordentliche Betriebsversammlung wurde deshalb angesetzt. „Sicher wird er jetzt konkrete Vorschläge für die Zukunft des Zweigwerkes Hartmann machen.“, dachten die Betriebsangehörigen.
Sie hatten recht!
„Liebe Mitarbeiter! Ich konnte neulich nachts wieder einmal vor Sorgen um die Firma Zunftherr nicht schlafen und da ist mir klar geworden: Die Firma Heinrich Hartmann hat bewiesen, das sie nicht wirtschaftlich arbeiten kann.
Die Kosten für die von uns an sie vergebenen Aufträge lagen um 50 Prozent höher als bei uns. Dann der Unsinn, mit der Arbeit am Russenauftrag vor Vertragsunterzeichnung zu beginnen, 25 Millionen zu investieren, und so Herrn Hartmann junior unter Druck zu setzen! Wir kommen deshalb zu dem Schluss: Es ist besser die Firma Heinrich Hartmann zu schließen, als auch die Firma Zunftherr zu gefährden!“
Ist das etwa kein konkreter Vorschlag?
Kein Wort davon, dass die 50 Prozent Mehrkosten daher rührten, dass alle notwendigen Vorrichtungen und Werkzeuge von der Firma Heinrich Hartmann neu angefertigt werden mussten, dass die Fertigungspläne umgestellt und die Menschen sich einarbeiten mussten und dass das alles nicht im ersten Jahr wieder eingespart werden konnte. Kein Wort davon, dass durch das schlechte Material vom aufgezwungenen Lieferanten große Verluste entstanden waren. Und kein Wort davon dass die Russen die Unerfahrenheit des jungen Hartmann ausgenutzt und ihn geleimt hatten.
Dass er es versäumt hatte, die Zahlungsmodalitäten gleich zu regeln – oder doch mindestens bei H.H. auf das Fehlen hinzuweisen, verschwieg der saubere Herr ebenfalls. Ein wütender Protest brandete Herrn Bartelmeier entgegen und der Betriebsrat hatte Mühe, ihn aus dem Raum zu bringen, bevor er gelyncht werden konnte. Ein Protestmarsch bildete sich spontan, eine wichtige Straßenkreuzung wurde zur Hauptverkehrszeit blockiert. Autofahrer schimpften über die Behinderung.

Die Zeitungen berichteten am nächsten Tag davon, jedoch kaum über den Grund des Protestmarsches: Das 1200 Arbeiter und Angestellte einer weltbekannten, traditionsreichen Firma um ihre Arbeitsplätze, um ihre Existenz kämpften, kämpfen mussten, weil eine unfähige Geschäftsleitung den Betrieb ruinierte und die Geschäftsleitung einer anderen Firma der lästigen Konkurrenz den Todesstoß gab. Die Zeitungen schrieben auch nichts darüber, dass die Politiker der einen Stadt geholfen und die der anderen Stadt nichts dagegen getan haben. Und Herr Siemsen stöhnte: „Das einer immer alles besser weiß, daran ist man ja gewöhnt, aber das der Broers dann auch noch recht hat mit dem, was er sagt, daran gewöhne ich mich nie!“ Die neuen Werkhallen der Firma Zunftherr waren außerhalb der Stadt in Rekordzeit fertiggestellt und eingerichtet. Die Produktion wurde verlagert. Ein paar Arbeitslose fanden wieder eine Verdienstmöglichkeit. Für einige Menschen wurde der Arbeitsweg kürzer. Aber die meisten waren länger unterwegs. Das Verkehrsaufkommen im Einzugsgebiet wurde zur Freude der Tankstellenbesitzer, der Reparaturwerkstätten und anderer Geschäftsleute erheblich größer. Auch das brachte neue Arbeitsplätze – und eine höhere Umweltbelastung durch längere Fahrtzeiten mit dem Auto, denn an eine Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr hatte niemand gedacht.
Die Firma Zunftherr hatte jetzt für den Stammbetrieb geräumige Werkhallen am Rande der Stadt, erstklassige Vorrichtungen und Werkzeuge von Heinrich Hartmann, und viele Tricks zur billigeren und trotzdem besseren Fertigung. Bessere Qualität in kürzerer Zeit. Gewusst wie! Und noch etwas erbeutete die Firma Zunftherr: Die bei HEINRICH HARTMANN neu entwickelte NC-Drehmaschine. Die Entwicklungskosten gingen selbstverständlich unter “ Verluste durch Heinrich Hartmann“in die Bilanz ein. Egal, ob bei korrekter Aufrechnung wirklich Verluste nachgewiesen worden wären oder nicht, der Beschluss war gefasst: „HEINRICH HARTMANN wird geschlossen!
Die Produktpalette, der Marktanteil wird von Zunftherr übernommen!“ 1000 Arbeitsplätze weniger in einer Großstadt, 200 weitere in einer kleineren – was macht Herrn Schuhler das aus, er behielt doch seinen Arbeitsplatz, sein Einkommen. Die Firma wurde nach seinen Worten auch nur „gesundgeschrumpft“ bis etwa 100 Mitarbeiter.
Als erste mussten die Lehrlinge gehen. Das mochte unabänderlich sein, aber musste Herr Schuhler es in dieser Form bekannt geben? „Guten Tag, meine lieben, jungen Freunde! Im Namen der Geschäftsleitung gratuliere ich Ihnen zur bestandenen Prüfung! Mit diesem erfolgreichen Abschluss Ihrer Ausbildung steht Ihnen der Weg in die Zukunft offen und dafür wünschen wir Ihnen alles Gute! Jetzt sind sie keine Auszubildenden mehr, sondern Fachkräfte. Ihr Ausbildungsvertrag ist somit beendet und sie können jetzt Ihre Papiere für das Arbeitsamt in Empfang nehmen. Wenn Sie sich beeilen, können Sie sich noch heute beim Arbeitsamt als Arbeitssuchende melden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg!“ Das war kurz, aber keineswegs schmerzlos! Verwirrt und betroffen sahen sich die jungen Menschen an. Das konnte doch nicht wahr sein, das träumten sie doch nur!
Sie meinten: „Wenn man nicht übernommen werden soll, muss das doch mindestens vier Wochen vor Auslaufen des Vertrages bekanntgegeben werden!“ Dann begriffen sie allmählich, dass sie nicht geträumt hatten! Selbst manchem jungen Mann standen Tränen in den Augen. Tränen der Wut und der Ohnmacht!
Was nützt es dass die Firma den Prozess vor dem Arbeitsgericht mit Pauken und Trompeten verlor, dass sie den entlassenen Mitarbeitern Lohn oder Gehalt für die gesetzliche Kündigungsfrist voll zahlen musste, das Bild vom Arbeitgeber war bei diesen jungen Menschen fürs Leben geprägt, und das der „Soziale Marktwirtschaft“ ebenfalls. Und Herr Schuhler handelte weiterhin im gleichen Stil: Bei den regulären Entlassungen – Verzeihung – Freistellungen sagte Herr Schuhler der Presse, man „müsste die Spreu vom Weizen scheiden“.
Dass er damit den jetzt arbeitslos gewordenen „lieben Mitarbeitern“ schadete, weil er sie als unfähig hinstellte, sie vor ihrer Familie, ihren Freunden und Bekannten blamierte und ihnen die Chance nahm, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, wen interessierte das?
Herr Schuhler jedenfalls nicht, er war ja nicht der Blamierte, er behielt seinen Arbeitsplatz. Das einzig Gute an dieser Gemeinheit war, dass der Betriebsrat sich nicht mehr täuschen ließ, er verlangte einen Sozialplan! Gestaffelt nach der Betriebszugehörigkeit und Lebensalter wurden Richtlinien ausgehandelt, die Abfindungen zwischen 100 Mark und 24.000 Mark ergaben. Für die meisten Betroffenen einige hundert bis ein paar tausend Mark, für einige wenige Mitarbeiter, die man an den Fingern abzählen konnte, bis zur Höchstsumme.

Prompt schrieb am nüchsten Tag die berühmt – berüchtigte Zeitung mit den vier Buchstaben:
„Was wollen Die paar Arbeiter, die von Heinrich Hartmann entlassen werden müssen, denn noch alles haben?
Sie bekommen doch schon 24 000.- DM geschenkt!“
Womit bewiesen war: Die halbe Wahrheit ist die gemeinste Lüge!
Selbstverständlich verlangte der Betriebsrat eine Richtigstellung!
Und er bekam seinen Willen. Nur: Hätte man ihm kein Belegexemplar geschickt in welchem die Seite der Richtigstellung aufgeschlagen und diese rot eingerahmt war, er hätte sie ebenso wenig gefunden wie die weitaus meisten Leser.
Der Betriebsrat sah es mit Empörung und meinte:“Zum Glück leben wir in einer Demokratie mit einer freien, unabhängigen Presse!“ Er wollte für die Kollegen das Schlimmste abwenden und setzte einen Text auf, in welchem alle beweisbaren Tatsachen aufgezeigt und Unwahrheiten richtig gestellt wurden. Dann wandte er sich an „die freie, unabhängige Presse“, an eine Tageszeitung nach der anderen und wollte diesen Text als eine, von Spenden der Belegschaft bezahlte, Anzeige aufgeben. Er bekam eine Absage nach der anderen! Überall der gleiche Sinn der netten Worte: „Das mag ja alles richtig sein, was Sie da vorbringen, und wir haben auch volles Verständnis für Sie und Ihre Kollegen. Aber Sie müssen auch uns verstehen! Wir leben schließlich von unseren Anzeigenkunden, und die würden uns keine Anzeigen mehr geben. . .“ So hatte sich der Betriebsrat die „Unabhängigkeit“ der „freien Presse“ nicht vorgestellt: Eine Presse, die Ihre Freiheit an Anzeigenkunden verkauft!
Ernst Broers,Hamburg
Auszüge aus den literarischen Lebenserinnerungen
„Ein Blick in eine fremde Welt. Heiteres und weniger Heiteres aus der Welt der Fabrik“
Barmbek Erinnerungen von Hermann Schulz. Meine Jugendjahre in Barmbek
Es sind wohl mehr oder weniger prominente Leute, die an ihrem Lebensabend ihre Memoiren schreiben. Ich kann mich keinesfalls zu ihnen zählen. Wenn ich trotzdem mit 74 Jahren meinen Lebensweg schildere, so weniger weil er besonders sensationell verlief, sondern weil meine Söhne meine gelegentlichen Erzählungen immerhin so interessant fanden, dass sie meinten, sie seien einer Aufzeichnung wert.
Wie für alle meine Altersgenossen des Jahrgangs 1900 waren die vergangenen 73 Jahre auch für mich interessant, aufregend und ereignisreich im Vergleich zu den fast eintönigen Lebensläufen meiner Vorfahren. (…)
Als ich 5 Jahre alt war, gaben meine Eltern die Terrassenwohnung in der Gärtnerstraße auf und zogen nach Barmbek in eine im vierten Stock gelegene Zweizimmerwohnung des neugebauten Wohnblocks der „Produktion“. Hier wohnten wir in der Ortrudstraße Nr. 37 bis zu meinem 28. Lebensjahr – also 23 Jahre. Derzeit lag der Wohnblock fast an der Grenze Nordbarmbeks und war von drei Seiten von Wiesen umgeben. Diese Wiesen, die Parkanlage Schleidenplatz (heute Biedermannplatz) und der damalige „Redder“ (heutiger Stadtpark) waren im Gegensatz zu der baumlosen Terrasse in der Gärtnerstraße ein wahres Eldorado zum Austoben für uns Kinder, abgesehen von dem Spielplatz mit Turngeräten innerhalb des quadratischen Wohnblocks. Man konnte in den ersten Jahren von unserem Balkon aus bis zum Barmbeker Bahnhof und bis zur Volksschule Lohkoppelstraße sehen. Erst später wurde das freie Gelände dazwischen mit Wohnhäusern bebaut.
Verständlicherweise war ich wegen der vielen neuen Spielmöglichkeiten begeistert von diesem Wohnungswechsel. Weniger mein Vater, der bis dahin als Stellmacher in der Werkstatt der Hamburger Straßenbahn am Falkenried tätig war und per Fahrrad nun einen einen sehr viel weiteren Weg hatte. Er wechselte bald darauf die Arbeitsstätte und war alsdann in verschiedenen Branchen der Holzverarbeitung – als Fenster- und Türenbauer, Anschläger, Mühlenbauer und Möbeltischer – tätig. (…)

Meine Mutter, mehr als mein Vater auf Gelderwerb bedacht, wünschte oft, dass er sich selbständig machen sollte, wozu ihm aber der Mut fehlte, insbesondere wohl deshalb, weil das erforderliche Kapital dazu nicht vorhanden war. Um diesem Mangel zu begegnen, nahm meine Mutter nach meiner Einschulung eine „Morgenstelle“ als Putzfrau in der Villa eines Weinagenten und später in gleicher Eigenschaft im „Haerlein-Stift“ an der Alster an. Von nun an wuchs ich als „Schlüsselkind“ auf. Ich musste selbst darauf achten, dass ich morgens rechtzeitig zur Schule kam und mir nach meiner Rückkehr das vorbereitete Essen warm machen. Neben den obligatorischen Schularbeiten hatte ich dann noch bestimmte Hausarbeiten zu verrichten. Dazu gehörte das Herauftragen von Kohlen und Kartoffeln von unserem Keller auf den vierten Stock, das Putzen der Messingteile an unserem Küchenherd, das Reinigen der Schuhe vom vorigen Tag sowie das „Einholen“ – also die Besorgung von Lebensmitteln nach einem Einkaufszettel. (…)
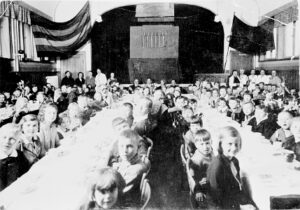
Unter diesen Umständen wuchs ich auf und entwickelte mich – zu oft auf mich allein gestellt – zum „Barmbeker Brieten“, der keinen Streichen und Raufereien aus dem Weg ging. (…)
Es fanden oft Schlägereien zwischen den Jungens verschiedener Straßenzüge statt, wie sie schon in dem 1967 erschienenen Buch „Barmbek – vom Dorf zur Großstadt“ in den Kapiteln „Barmbek-Uhlenhorster Grenzkampf“ und „Barmbeker Jugend – einst wie heute“ anschaulich beschrieben wurden. Ergänzend kann ich noch berichten, dass auf diesem Gebiet wir Jungens aus dem Wohnblock der „Produktion“ besonders angefeindet wurden. Wir galten als besonders rote „Sozis“, weil der Gebäudekomplex fast nur von Sozialdemokraten bewohnt wurde. Wir duldeten keine „Fremden“ auf dem im Innern des viereckigen Wohnblocks befindlichen Spielplatz, auf dem sich außer zwei Sandkisten auch Kletterstangen und ein Reck befanden. Um unsere „Burg“ zu erobern, rotteten sich die „Fremden“ oft zusammen. Wenn es uns gelang, sie in die Flucht zu jagen, zogen wir anschließend – zum Beispiel – mit dem Ruf „Sentastroot (Sentastraße) hätt een Morsfull kregen – rou, rou, rou“ unsere Stöcke und Latten schwingend durch deren Straße, bis ein „Udl“ (Schutzmann) uns auseinanderscheuchte. Dabei waren diese „Waffen“ nicht ganz ungefährlich, weil an deren Enden oft Nägel oder mit einem Stein beschwerte Töpfe befestigt waren. Hierbei möchte ich erwähnen, dass derzeit unser späterer Senator und Bürgerschaftspräsident Adolph Schönfelder auf dem Saal des Wohnblocks „Produktion“, das von dem Lokal „Mause“ bewirtschaftet wurde, als relativ junger Mann seine ersten Reden hielt. Mein gleichaltriger Vater als ständiger Besucher dieser Versammlungen meinte jedenfalls, Schönfelder hätte sich hier im Redehalten geübt. Vorausgreifend – weil bezeichnend für das frühere, rauhe, politische Klima in Barmbek – sei hier noch eingefügt, dass bei dem Aufstand der Kommunisten 1923 die Polizeiwache am Barmbeker Markt als erste in Hamburg von ihnen erstürmt und bis zuletzt verteidigt wurde.
Für uns Volksschüler waren die Realschüler der Osterbekstraße – erkennbar an ihren derzeit traditionell rot-schwarz-gestreiften Sweaters – ein rotes Tuch. Sobald sie in unsere Nähe kamen, und das war auf deren Schulweg fast täglich der Fall, wurden sie von uns angerempelt und sofern sie reagierten auch tätlich angegriffen. Zu unserer Ehre muss ich allerdings sagen, dass wir darauf achteten, dass die Streithähne den Kampf unter sich austragen mussten. Obgleich in der Überzahl mischten wir uns auch nicht ein, wenn einer der unsrigen dabei unterlag – gemäß unserem Motto: „Twee op eenen is feige“ (Zwei auf einen ist unfair).

Der „Redder“ (heutiger Stadtpark) war in seinem damaligen Zustand ein ideales Gelände für unser Kriegsspiel „Insche (Indianer)“ und „Trapper“, ein bei den Jungens beliebtes Spiel, wobei die Mädchen als Krankenschwestern fungierten. Die Bäume und Sträucher boten sich direkt an, um sich als Indianer an den Feind – die Trapper – heranschleichen zu können und sie mit Pfeil und Bogen oder dem Tomahawk zu bekämpfen. Den Abschluss bildete dann ein Freudenfeuer, um das wir herumtanzten und sangen. Die Melodie und den vollständigen Text des Indianerliedes, das mit den Worten: „Tsching – tschang – gulla – gulla – gulla“ begann, habe ich noch heute im Gedächtnis. Hin und wieder muss ich dieses Lied jetzt noch meinen vier Enkelkindern vorsingen.
Hermann Schulz
Barmbek Erinnerungen von Kay Krause. Roller-Geschichten

Dat wär woll 1951, kann ok 52 sien.
Ick wär wedder mit mien Luxusroller ünnerwegens as jeden Nomiddach, wull mien Oma inne Humboldtstroot besöken.
Eers den Schlicksweg lang, und denn säh‘ ick all dat Mallör op de grote Krüzung Habichtstroot – Steilshoperstroot:
een olen „Tempo“ Dreerad-Lieferwogen stunn man blots noch op de twee Achterbeen, datt Vorderbeen wär em wechknickt, harr woll Athrose, oder sowatt. Ick kann ju vertellen: datt säh man bannich unglücklich ut. Ober datt beste wär: de hett Eier oploden hatt! Nu wär de ganze Krüzung vull mit Röhreiers, und ’n poor Eiers wärn ok noch ganz, und de Lüüd kääm mit Tüten und Taschen und sammelt in, watt noch to bruken wär.
Na ja, ick hebb mi datt ’n Tiedlang mit ankeken und bin denn wiederfohrt, de Steilshoper Stroot lang und denn rechts inne Hellbrookstroot, noch’n poor hunnert Meters und denn wär links anne Eck vonne Schwalbenstroot een groten freien Platz, schrääch gegenöber vonne Post. Op düssen Platz stunn nu een Wogen, weest, so’n Wogen as de Lüüd von Zirkus hebbt, för de Viecher, för all de Utensilien, und ok to’n Wohnen mit de Artisten und de Familie. Twee Meter föftich breet, acht oder neegn Meter lang, mit’n Dachwölbung und Flügldöörn an beide Sieden. De een Flügldöör stunn op, door wär een Mann bien Rumpütschern, und ick kunn in den Wogen rinkieken. Glieks achter de Döör wär op’n Boden een Stüerrad montiert, dor achter stunn een Stohl. Inne Mitt von den Wogen wär een Wand. Anne Front ’ne Trepp to’n op- und doolklappen.
De Mann wär dorbi, anne föftein Klappstöhl in den Wogen in Reih und Glied optostelln. Ick frooch em, wat dat war’n sall, und he vertellt mi, datt he Film-Theoter mookt för Kinners. Und nu säh ick ok een Leinwand an de Mittelwand, und he wär dorbi, een lütten Projektor mit Handkurbel optostelln. Ick froch em, watt datt kost, und he seggt: „Zwanzig Pfennig, mein Jung'“. Ick segg to em, datt ick ober keen twintich Penn gor nich hebb. Door kümmt he de Trepp dool, leggt mi de Hann op de Schuller und seggt: „Denn fohrst du nu mit dien Roller gau no Huus und seggst dien Modder, sei sall mi ’n poor belegte Brote moken, und denn kümmst wedder her und kannst di den Film ankieken“. Ick bün afsuust as’n Rakete. As ick wedder öber de Krüzung Habichtstroot kumm, wär de Füerwehr all dorbi, den ganzen Eiermatsch in’n Gulli to speueln. De Fisch inne Alster ward sick wunnert hebben öber dat nahrhaftige Fudder.
Een Abschleppwogen nähm dat kranke Dreerad all huckepack, ober ick harr keen Tied too’n Kieken.
To Huus hebb ick Moddern de ganze Geschicht vertellt. Se hett veer Schieben Brot afsneeden, Margarine opsmeert, Wurst und Kääs good oppackt, tosomklappt, in Pergamentpapier inpackt, und ick bün wedder tröchsuust. De Mann hett sick bedankt und ick döff mi een Stünn lang ole Filme ankiecken, swatt-witte Stummfilme mit Buster Keaton und Dick und Doof. As de Filmkiekerei to Enn wär, hett de fründliche Mann mi noch sien ganzes lüttes Riek wiest. In dat achtere Stück von den Wogen leeft he mit sien Fru und twee lütte Kinners, op tein Quadratmeters. Ober dat wär allns gemütlich und harr Hann und Foot: inne een Eck ’n lütten Ofen too’n Heizen un Kooken, anne Sied ’n Klappsofa för de Öllern too’n Sloopen, inne anner Eck ’n lütt Etagenbett för de Kinners. Inne Mitt wär grood noch Platz för’n lütten Tisch und twee Stöhl. Und datt hett he sick allns sölben utdacht un sölben tosombastelt!
Und dat beste wär: ünner den Boden, glieks neben de achterliche Achse, hett he een olen Volkswogen-Motor montiert, de hett der Achterräders antreben. De harr ober blots een Gang. Wenn he nun von een frei’n Platz to den nächsten dörch Hamborg ünnerwegens wär, denn mokt he de Flügldöörn vorn op, sett sick op sien Stohl achter dat Stüerrad, kuppelt in und fohrt mit veeruntwintich PS un fief Kilometers inne Stünn dörch den Verkehr. Man blots: Verkehr gääv dat eben dormols noch nich! Süh, und watt datt in de dormolige Tied för een Abenteuer wär, datt kannst doran sehn, datt ick datt nich vergeeten hebb. Nu stell di mol för, du geihst hüt no de Kinokass mit dien Deern, leggst ’n Botterbrotpaket op’n Tresen und seggst to de schnieke Lady op de anner Siet: „Twee mol letzte Reihe bitte!“ Kann woll good angohn, datt se di afholt und ünnersöken lot von een Fachmann.
Kay Krause 09. Dezember 2016
Barmbek Erinnerungen von Prof. Dr. Gerd Kobabe. Unser Geldschank unter Trümmern in der Hamburger Straße
Ich bin mit Eltern und Großeltern in der Hamburger Straße 18 aufgewachsen, wo meine Eltern ein Juweliergeschäft – „Julius Kobabe & Sohn“ – hatten. In meiner Jugend habe ich den umliegenden Stadtteil mit meinem Tretroller (Vollgummibereifung) ausgiebig erkundet. Zur Schule gegangen bin ich im Klinikweg 5. Mit 10 Jahren kam ich in die Oberschule Uferstraße. Kurz danach brach der Krieg aus. Nach der Einberufung meines Vaters und unseres Uhrmachers zur Wehrmacht wurde das Geschäft wie so viele andere „vorübergehend“ geschlossen. Zu Beginn der Sommerferien 1943 schickte mich meine Mutter zu Onkel und Tante nach Hertefeld, ein kleines Dorf im Havelländer Luch. Die Schreckensnächte in den letzten Julitagen habe ich also nicht direkt miterlebt. Meine Mutter wurde mit anderen Leuten aus dem Luftschutzkeller aus der brennenden Stadt gefahren.

Juweliergeschäft Hamburger Straße
Die Häuser zwischen der Hamburger Straße und der Oberaltenallee wurden durch Bomben und Feuer Ende Juli 1943 fast alle mehr oder vollständig zerstört. So erging es auch unserem Haus mitsamt dem Uhren-, Gold- und Silberwarengeschäft. Was blieb, war ein großer Trümmerhaufen, aus dem meine Mutter später nur eine heile Tasse und einen heilen Eierbecher herausklauben konnte. Sorgen machte meinen Eltern der Geldschrank, der irgendwo unter den Steinen lag. Mein Vater bekam erst im Oktober Sonderurlaub, damit er regeln konnte, was noch zu regeln war. Vornehmlich musste der Inhalt des Geldschranks geborgen werden. Mein Vater und ich machten uns also mit Kreuzhacke, Hammer und Meißel wie die Panzerknacker auf den Weg von Farmsen, wo wir Unterkunft gefunden hatten, nach Süd-Barmbek. Die Walddörferbahn fuhr nur bis zum Bahnhof Barmbek; dann ging’s zu Fuß weiter. Man hatte uns zwei Hilfskräfte zur Verfügung gestellt ( zwei frontuntaugliche alte Männer, natürlich in entsprechender Uniform ). Zu viert machten wir uns an die Arbeit. Da die Rückwand unseres Hauses stehen geblieben war, konnten wir die wahrscheinliche Lage des Geldschranks unter dem Trümmerberg einigermaßen genau lokalisieren. Wir hatten Glück und fanden den Schrank, nachdem wir Steine und Steinbrocken weggeräumt hatten. Aber welche Überraschung. Der eiserne Schrank war noch so heiß, dass wir ihn nicht anfassen konnten! Und das ist kein Jägerlatein. Fast zehn Wochen hat er nach dem Bombenfeuer wie in einem Backofen unter dem Schutt gelegen und strahlte immer noch so viel Hitze aus, dass ein Arbeiten an ihm unmöglich war. Wir fragten uns, wie es wohl in seinem Innern aussehen mag und ob wir die Schlösser überhaupt aufkriegen würden? Nachdem wir den Schrank zum Auskühlen noch etwas weiter frei gelegt hatten, wurde er zur Tarnung mit herumliegenden Blechen leicht bedeckt, und dann fuhren wir enttäuscht unverrichteter Dinge wieder nach Hause.

Trümmer Hamburger Straße
Am übernächsten Tag wurde die Tarnung wieder beiseite geräumt. Jetzt kam der spannende Moment, an dem sich herausstellen wird, ob sich die Schlösser öffnen ließen. Der Schrank war zum Glück auf seine Rückseite gefallen, so dass man an die Schlösser leicht heran kam. Und dann – oh Wunder, sogar das komplizierte Sicherheitsschloss gab nach und die Schranktür ging auf.
Den Schatzgräbern bot sich ein pechschwarzes Etwas. Die Kartonagen, in denen die Taschen- und Armbanduhren und die Schmuckwaren verpackt waren, waren vollkommen verkohlt. Rührte man die Masse an, zerbröselte einem alles aus den Händen. So blieb nichts anderes übrig, als mit einem Kehrblech die schwarze zerfallende Masse zusammen mit den Schmuckwaren in mitgebrachte alte Emaille-Eimer zu schaufeln. Im unteren Teil des Geldschranks hatte meine Mutter meine und meines Vaters Briefmarkenalben verstaut. Alles schwarz und zerfleddert. Nachdem die beiden Hilfskräfte je einen goldenen Ring als Dank für ihre Hilfe bekommen hatten und die Eimer mit Zeitungspapier abgedeckt waren, zogen wir wieder zur Hochbahn und fuhren nach Hause. Wenn die Mitfahrenden gewusst hätten, was da in den alten Eimern für Schätze drin gewesen sind! Es hat noch Tage gedauert, bis alles mit der Pinzette Krümelchen für Krümelchen nach kleinsten Edelsteinen durchsucht worden war; denn diese waren von den verkohlten Bröckchen kaum zu unterscheiden.
Barmbek Erinnerungen von Kay Krause

In den Jahren nach dem Kriege war es aufgrund der großen Wohnungsnot in Hamburg den Schrebergärtnern von behördlicher Seite erlaubt, in ihrem Garten die vorhandene Laube für Wohnzwecke zu erweitern bzw. ein kleines Wohnhaus zu bauen. Mein Stiefvater entschied sich zu Letzterem.
Ort des Geschehens: Kleingartenverein „Am Grenzbach e.V.“ in der Dieselstraße, Parzelle 21. Vaddern begann damit 1949, selbstverständlich nach einem langen Arbeitstag und am Sonntag. Muttern verbrachte trostlose 3 Jahre in einer Lungenheilstätte in Wintermoor, wurde morgens mit dem Liegestuhl in die Sonne geschoben und abends wieder hereingeholt, das war die ganze Therapie für TBC-Kranke. Sie hat’s überlebt, die meisten ihrer Bettnachbarn sind gestorben.
Ich – 6 Jahre alt – war bei diesem Versuch der hamburger Bürger, den Schutt der Bomben wegzuräumen und neu aufzubauen, quasi das 5 Rad am Wagen und total überflüssig. So verbrachte ich meine Kindheit bei verschiedenen Verwandten und zuletzt im Kinderheim Neugraben, wo ich auch zur Schule kam.
Am Sonnabend Nachmittag ging ich dort zum Bahnhof, fuhr mit der Bahn bis HH-Hauptbahnhof, von da mit der Straßenbahn bis Hellbrookstraße, und die restlichen 15 Minuten zu Fuß zur Dieselstraße. Dort war Vaddern schon am Werken und wartete auf mich. Mit der hölzernen Schiebkarre und einem Maurerhammer ausgerüstet zog ich los, auf die andere Straßenseite, in die Trümmer.
Die Dieselstraße ist vom Schlicksweg bis zum Elligersweg ca. 500 Meter lang, links die Schrebergärten, rechts stand vor dem Krieg eine ebenfalls fast 500 Meter lange Reihe von drei- bis viergeschossigen Wohnhäusern. Vom Erzählen der Nachbarn weiß ich, dass englische Flieger mit Brandbomben diese ganze Häuserzeile mitsamt den Bewohnern platt gemacht haben. Stehengeblieben ist nur der u-förmige Ziegelbau am Ende zwischen Dieselstraße und Oertzweg.
Diese Trümmer waren nun mein Arbeitsfeld. Meine Aufgabe war es, alte Mauersteine vom Putz zu befreien, auf die Schiebkarre zu laden und zum Neubau zu fahren. Ja, lieber Leser, Du hast recht: es gibt keinen Maurerhammer für sechsjährige Kinder, es gab damals auch keine Arbeitshandschuhe für Kinder. Meine Hände waren zerschunden, Muskeln und Knochen taten weh, und trotzdem hat’s Spaß gemacht! Ich bin am Sonntag Abend glücklich und zufrieden nach Neugraben zurückgefahren. Vaddern hat sich über jeden Stein gefreut, den ich ihm sauber abgeklopft brachte, den er nicht kaufen mußte; ich weiß noch, dass ich über’s Wochenende an die 100 Steine geschafft habe. Pro Stein habe ich 1 (in Worten: einen) Pfennig bekommen. Ein neuer Kalksandstein kostete damals 7 Pfennig, soviel wie ein Brötchen. Es war mein Taschengeld für die ganze Woche. Andere Kinder hatten gar kein Taschengeld.
1951 kam Muttern aus der Klinik, das Häuschen war fertig und wir zogen zusammen mit meiner Tante ein. Die Wände waren noch nicht verputzt, roher Zementfußboden, aber Fenster und Türen waren drin, jedes der 3 kleinen Zimmer hatte einen Ofen, und letztlich war auch noch Geld übrig für Holz und Kohlen.
Ein paar Jahre später wurde nach und nach auch die gegenüberliegende Häuserzeile wieder aufgebaut. Nun waren nicht mehr die Trümmer, sondern die Baugerüste unser Spielplatz. Mein Elternhaus wurde nach dem Tod meiner Mutter im Jahre 2001 als eines der letzten verbliebenen Wohnhäuser in dieser Gartenkolonie abgerissen. Parzelle 21 ist nun wieder ein ganz normaler Schrebergarten.
Kay Krause 30. November 2016
Barmbek Erinnerungen von Bettina Sattler - Holzky. Abschiedsbesuch in einem sterbenden Idyll? Zu Besuch im "Dieselstraßenland"
In der vergangenen Woche war ich endlich mal wieder mit etwas Zeit in meiner Geburtsstadt Hamburg und bin mit dem Rad in meine „alte Heimat“, die Dieselstraße in Barmbek Nord gefahren. Ich (Jahrgang 58) bin in der Dieselstraße (Nr. 58) aufgewachsen und habe dort eine ziemlich glückliche Kindheit verbracht – nicht zuletzt wegen der Kleingärten gegenüber. Jeder kannte damals jemanden, der so einen Garten sein eigen nannte, in dem man herrlich spielen, seine eigenen Beete anlegen und frisches Obst naschen konnte. Im Herbst gab es immer irgendwo ein „Apfelfeuer“, und im Winter spielten wir Kinder bei der Weihnachtsfeier des Kleingartenvereins im Vereinshaus beim Weihnachtsmärchen mit – auch Kinder wie ich, deren Eltern dort weder Mitglied waren noch einen Garten hatten. Das war ganz selbstverständlich. Der Verein und die Gärten hatten damals viele Funktionen für die dort lebenden Familien: Sie waren ein sicherer Spielplatz für die Kinder, boten Selbstversorgung mit frischem Obst und Gemüse sowie Gelegenheit zum kurzen Schnack am Gartenzaun, wenn man von der Schule, der Arbeit oder vom Einkaufen nach Hause kam. Und sie vermittelten, ganz wichtig, ein kleines bisschen das Gefühl von Freiheit für die Bewohner der eher kleinen, engen Barmbeker Mietwohnungen. Von der Funktion der Gärten als „grüne Lungen“ sprach man damals noch kaum. Eher hat man im Schutz der Hecken heimlich die ersten Zigaretten geraucht! Doch jeder wird sich gern an die warmen Sommerabende erinnern, wenn man nach einem heißen Tag die kühler werdende, nach Sommerblumen duftende Gartenluft durch das offene Wohnzimmerfenster hereinließ! Auch an diesem Sommerabend, der zwar nicht heiß ist, aber immerhin ein Sommerabend im Juni 2016, haben viele Mieter ihre Fenster weit geöffnet.
Das Gebiet, das heute so nett „Dieselstraßenland“ genannt wird, stand in den vergangenen Jahrzehnten schon öfter auf dem „Hamburger Abrissplan“. Zum ersten Mal, als ich gerade von meinen Eltern ausgezogen war, also vor knapp 40 Jahren. Es hat sich aber immer halten können. Umso erschrockener bin ich, als ich jetzt erneut die vielen Plakate sehe, und auf der dort genannten Homepage der „Bürgerinitiative Dieselstraßenland“ erfahre, dass der Abriss bereits beschlossene Sache ist.
Mit beklommenem Gefühl radle ich meine alte Straße entlang und versuche mir vorzustellen, wie sie ohne das freundliche Gegenüber wohl aussehen würde. Wohnblock reiht sich in der relativ langen Straße hier an Wohnblock, eine „Architektur“, die nur durch die schönen Gärten gegenüber weder hart noch kalt wirkt. Den ganzen Nachmittag scheint hier die Sonne. Die Gärten aber einmal weggedacht und an ihrer Stelle eine höhere Bebauung? Ziemlich trostloser Gedanke!

Die Dieselstraße aus Richtung der
Hochbahnstation Habichtstraße.
Links die Kleingärten, denen der
Abriss droht. Ende einer ruhigen Zeit?
Es ist, wie gesagt, ein schöner Sommerabend, als ich an den Gärten entlang radle. Wie früher kommen viele Leute in ihren Garten, um dort ihren Feierabend zu genießen. Wie früher spielen Kinder in den Gärten. Und wie früher mischt sich Rosenpracht mit roten Johannisbeeren. Zwischen den geparkten Autos stehen die alten Eichen am Straßenrand – wie viele Körbe voller Eicheln wir Kinder wohl damals gesammelt haben? An einigen Stellen ist der Weg inzwischen ganz schmal neben den alten Bäumen – die älteste Eiche ist beeindruckende 110 Jahre alt, hat zwei Weltkriege, den ersten Sauren Regen und etliche Kletterpartien überstanden. An ihrem Fuß wurden mit dem Absatz Löcher für das Marmelspiel in den Boden gebohrt. Manche Jungs konnten nicht abwarten, bis die Eicheln von allein auf den Boden fielen. Mit dicken Knüppeln warfen sie nach den begehrten Früchten und holten damit meistens mehr Laub als Eicheln vom Baum. Anderswo werden solche alten Stadtbäume gehegt und gepflegt. Aber die Barmbeker sind einfache Leute. Ihnen „gehören“ ihre Gärten nicht, sie haben keine Rechte an den angrenzenden Wegen, sie haben keine Lobby. Und wenn sie nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen, werden ihre schönen alten Bäume wahrscheinlich gefällt werden. Dann wird ein stattlicher alter Baum, der über hundert Jahre gewachsen ist, in wenigen Minuten zu einem gesichtslosen Holzstapel verarbeitet sein, der bei Gelegenheit abtransportiert werden wird.

Die prächtige Eiche aus dem
Jahr 1906 – Wie lange wird es
sie hier noch geben?
Ich fahre weiter und freue mich, dass die schöne Buchenhecke um die Gärten herum noch immer ganz „altmodisch“ über den Türen zu den Parzellen im Bogen geschnitten wird, diesen kleinen Türen in unterschiedlichen Farben und Formen mit der Parzellen-Nummer und dem Namensschildchen dran. Anders als früher gibt es hier heute auch Namensschilder mit Namen aus fernen Ländern. Viele Zugezogene haben hier ihr eigenes kleines Reich gefunden – Integration, sie scheint hier kein Fremdwort, keine leere Worthülse zu sein!
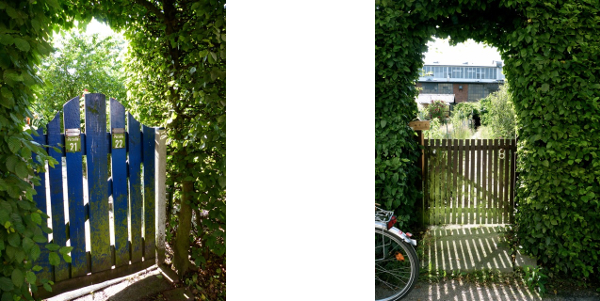
Verschiedene Türen, Farben und Nationalitäten – ein ganz unspektakuläres
friedliches Miteinander im Kleingarten. Rechts im Hintergrund die Werkstätten
der Hamburgischen Staatsoper, früher Schiffbau-Versuchsanstalt.
Heute sind die Gärten erfreulicherweise längst nicht mehr so aufgeräumt wie früher. Man findet schon mal ein aus rohen Brettern zusammengezimmertes Baumhaus oder auch etwas „schräge“ Skulpturen neben den alteingesessenen Gartenzwergen. Sogar hölzerne Füchse machen ihnen Konkurrenz, aber die Zwerge halten tapfer die Stellung! Kein Kleingartenverein ohne Zwerge! Aber Kleingärten waren schon immer ein Ort der Vielfalt. Auch wenn sie heute etwas anders aussehen als früher, stellen sie nach wie vor so etwas wie kleine Fluchten dar, Fluchten aus einem genormten und oft grauen Alltag. Und wie früher sind es auch heute die einfachen, die „kleinen“ Leute, die diese Fluchten suchen und brauchen. Leute, die kein Geld für ein Haus mit Garten haben, und die in ihren Gärten ein Stück Freiheit finden, sich selbst versorgen oder auf andere Art ihre Ideen verwirklichen. Die Ästhetik der Kleingärten ist vom Individualismus ihrer jeweiligen Bewohner geprägt und lässt sich nicht ikea-isieren! Und um diese Vielfalt tut es mir mindestens ebenso leid, wie um die alten Bäume und den freien Blick aus den Fenstern der Wohnungen!

Ob Sägearbeit oder Klein-Imkerei – Kleingärten bieten Menschen
Entwicklungsmöglichkeiten, die in kleinen Wohnungen nicht zum Tragen
kommen könnten.
In einer dieser Wohnungen wohnte damals meine Freundin Karin, zwei Jahre jünger als ich. Als ich ihr mein Poesie-Album gab, tat sie etwas, was wir „älteren Damen“ uns gar nicht mehr getraut hätten: sie dichtete ein 08/15 – Gedicht auf unsere Straße um. Liebe Bettina, schrieb sie,
Wenn du einst in spät’ren Jahren
dieses Büchlein nimmst zur Hand,
denk daran, wie froh wir waren
in der kleinen Dieselstraße.
Recht hatte sie! Damals aber, das muss ich zugeben, störte mich der fehlende Endreim. Heute dagegen freue ich mich über dieses kleine, ganz besondere Gedicht! Vielleicht hätte ich Karin ohne dieses Gedicht längst vergessen? Nein, natürlich nicht, und ich werde auch vieles andere hoffentlich nicht so schnell vergessen. Das direkt hinter den Gärten liegende Gelände der Schiffbau-Versuchsanstalt zum Beispiel, auf dem wir alle das Radfahren lernten und übten, immer um „die Insel“ herum!

Die „Insel“ war vor einem halben Jahrhundert noch nicht ganz so hoch bewachsen – sonst hat sich aber nicht viel verändert.Hier lernten die „Dieselstraßen-Kinder“ das Radfahren – ohne Helm, aber auch ohne jeglichen Straßenverkehr! Auf der Rampe im Hintergrund musste man abwarten, bis das nächste Rad frei war, denn noch längst nicht jeder besaß ein eigenes Fahrrad!
Später rasten wir die Auffahrt zum Gelände hinunter – unten an der Dieselstraße stand immer einer Wache und gab ein Zeichen, falls ein Auto kam. Wir passten gut aufeinander auf! Der kleine Martin wurde bei einer anderen Gelegenheit dennoch einmal von einem Auto angefahren und trug schwere Verletzungen davon. In der Folge wurde die durch parkende Autos etwas unübersichtlich gewordene Dieselstraße einige Jahre lang zur Einbahnstraße. Inzwischen ist die enge Straße aber wieder in beide Richtungen befahrbar; schnell fahren kann man hier heute nicht mehr.

Fast verwunschen wirkt die alte Auffahrt,
die zum Gelände der früheren
Schiffbau Versuchsanstalt führt.
Es kümmert sich wohl einfach niemand
mehr um Hecken, die bald abgerissen werden sollen…
Heute gehört das ehemalige Schiffbau-Gelände zur Hamburgischen Staatsoper, die dort Probebühnen und Werkstätten unterhält. Angesichts meiner Abschiedsstimmung traue ich mich, über den Schlicksweg das Gelände hinter den Gärten zu erkunden. Der Pförtner dürfte mich wohl nicht hinein lassen, aber er sieht mich ja nicht…

Ein Protestplakat, das nicht zur Dieselstraße,
sondern zum Gelände der
Hamburgischen Staatsoper hin ausgerichtet ist –
oder ist es hier nur abgelegt worden?
Rund um die Werkstätten der Hamburgischen Staatsoper liegen etliche Bühnenteile herum, eine skurrile Landschaft. Ich frage mich, ob wohl auch das Gebäude der Hamburgischen Staatsoper vom Abriss bedroht ist. Ich weiß es nicht… Vielleicht ist es reiner Zufall, aber das Aufhängen gewisser Requisiten lässt den Gedanken irgendwie naheliegend erscheinen..

Beim Anblick der Totenköpfe muss ich plötzlich an den großen nächtlichen Brand denken, der das lang gestreckte Gebäude in den späteren 70er-Jahren im mittleren Abschnitt teilweise zerstörte. Mein Vater weckte mich damals mit dem unvergessenen Satz: „Willst du mal ein richtig großes Feuer sehen?“ Ich wollte! Der Anblick war überwältigend. Und niemals zuvor hatte ich eine Ahnung davon gehabt, welch einen unglaublichen Lärm so ein Großfeuer macht. Bei jeder unsichtbar einstürzenden Innenwand fuhren wir erschrocken zusammen. Der ohnehin schwache Wind stand aber günstig, so dass wir nicht um unsere Häuser bangen mussten. Wir wohnten im dritten Stock, Logenplatz also! Dennoch trieb es mich bald zu den Freunden und Nachbarn nach draußen. Die Straße leerte sich erst nach Stunden, als es endlich hieß, niemand sei in den Flammen umgekommen. Erleichtert gingen die Bewohner der Dieselstraße zurück in ihre Wohnungen. Ich selbst nutzte die Gelegenheit für meinen ersten nächtlichen Besuch bei meinem damaligen Freund, der ebenfalls in der Dieselstraße wohnte, ganz am anderen Ende allerdings. Es gab ja noch kein Handy, mit dem meine Mutter mich hätte zurück beordern können! Die Welt war doch in mancher Hinsicht noch in Ordnung damals. Das kräftige Donnerwetter meiner Mutter am nächsten Morgen, es war ein Samstag, war im Zuge der allgemeinen Aufregung bald vergessen. Gegen Mittag wurde am Schlicksweg eine riesige Gulaschkanone für die Feuerwehrleute aufgestellt, die fast das gesamte Wochenende im Einsatz blieben. Genau an der Stelle, an der ich jetzt das Gelände der Hamburgischen Staatsoper verlasse, saßen die Feuerwehrleute gemütlich da und aßen in Schichten zu Mittag. Von Hektik keine Spur. Dieses Bild hat sich mir derart eingeprägt, dass ich meinem ältesten Sohn, als er im Alter von etwa vier Jahren vom Playmobil-Feuerwehr-Fieber gepackt wurde, davon erzählte. Von da an baute er zu seinen Feuerwehreinsätzen immer einen Tisch mit Essen und Trinken dazu auf. Er ist inzwischen 25. Ich muss ihm die Stelle wohl schnell noch einmal zeigen – bevor es zu spät ist!
Bettina Sattler-Holzky, geschrieben am 4. Juli 2016
Barmbek Erinnerungen von Peter Oebel. Ein Weihnachtsgeschenk von Walter Messmer. Auszug aus dem Buch Alex von Peter Oebel

Ganz in unserer Nähe, nämlich in der Hufnerstraße bei Walter Messmer, dem noblem Fachgeschäft, das feine Süßwaren, erlesenes Gebäck und spezielle Kaffee- und Teesorten verkauft, da gibt es für gewöhnlich – und das besonders um die Weihnachtszeit herum – so schöne Vorratsbehälter für den Kaffee. Runde oder eckige Blechdosen mit einem stramm sitzenden, fest schließenden Deckel, die ziemlich genau ein Pfund ungemahlenen Kaffee aufnehmen können. Rundum sind sie von jeher mit einem netten Motiv versehen – gelegentlich sogar nach einem romantischen Ölgemälde als Vorlage –, das die Dosen, diese Schmuckdosen! – ganz zweifellos zu einem wertvollen Geschenk macht. Darüber würde meine Mutter sich ganz bestimmt freuen. Auf jeden Fall werde ich versuchen, für sie so ein Prachtstück zu bekommen. Die Walter Messmer Filiale in der Hufnerstraße verschenkt jene Dosen in der Adventszeit an ihre Kunden. Eine wirklich nette Geste, die sich inzwischen herumgesprochen hat. Das wirklich Dumme ist nur, dass jenes schöne Präsent immer in Verbindung mit einer dort im Geschäft gekauften Ware – Kaffee, in der Regel – ausgegeben wird: ein Pfund Kaffee der Sorte „Mein Bester von Walter Messmer“ – zum Beispiel –, und schon stellt einem eine der freundlichen Verkäuferinnen das Gewünschte einschließlich der begehrten Trophäe auf die gepflegte polierte Glasfläche der Ladentheke. Genau so läuft das ab. Jedenfalls für jeden, der das Geld für ein Pfund Kaffee in der Tasche hat, was bei mir eben nicht der Fall ist, nicht, wenn ich darüber hinaus noch weitere Geschenke besorgen muss. Vielleicht – ja, vielleicht kann ich eine der Verkäuferinnen überreden, dass sie mir eine Dose schenkt, ohne das ich Kaffee oder sonst irgendetwas dort einkaufe. Die Möglichkeit besteht immerhin. Ich denke, dass es mit geringstenfalls gelingen wird, einen Walter-Messmer-Jahreskalender für das kommende Jahr zu bekommen. Der liegt dort zwar auch nicht stapelweisefrei herum, sodass sich ihn jeder am Kalender interessierte kurz schnappen und unauffällig wieder fortgehen kann, das nun nicht, aber er wird gerne und ohne zu Zögern auf Anfrage ausgegeben. Das habe ich vom letzten Jahr noch gut in Erinnerung. Das Motiv auf dem Deckblatt des Kalenders, das ist ebenfalls ein sorgsam ausgewähltes, was ihn auch zu einem ganz passablen Geschenk macht.(…)

(…) Bis zur letzten Minute habe ich zwar kämpfen müssen, um all die geplanten Besorgungen zu erledigen, letztlich hat es dann aber noch ganz gut geklappt. Selbst die schöne Kaffeedose für meine Mutter habe ich bekommen. „Hier, mein Junge, kein Problem, die schenke ich Dir doch gerne!“ Die nette junge Dame von Walter Messmer hat mir mit Ihrem Verständnis für meine Situation ziemlich aus der Patsche geholfen. „Einen Jahreskalender stecke ich die auch noch mit in die Tüte. Frohe Weihnachten!“ Kaffee musste ich nicht kaufen.(…)
Hamburg, 2015 Peter Oebel
Barmbek Erinnerungen von Wolfgang Wulff. Die ersten Fernsehbilder – in der Nissenhütte

Nissenhütten mit Kindergruppe, auf dem Mittelstreifen am Pfenningsbusch,
Höhe Stückenstraße/Kraepelinweg.
Aufnahme 1953. In der untersten Reihe, linksaußen: Wolfgang Wulff
Wir haben damals viele Nachmittage mit den Kindern aus der Nachbarschaft in dieser Hütte verbracht. Was uns alle lockte, war die Möglichkeit dort fernzusehen! Den Namen des Besitzers kenne ich heute nicht mehr. Er hatte die Hütte längs in der Mitte in zwei Räume geteilt. Den rechten Teil, durch den man auch die Hütte betrat, bewohnte er mit seiner Familie(?). Der linke Teil war das „Kino“ mit dem Fernseher und einer Anzahl von Bänken – oder besser – Brettern, auf denen wir saßen. Ich glaube, er verkaufte auch Süßigkeiten. Doch dieses Nachmittagsvergnügen fand bald ein Ende. Von unseren Eltern hatten wir gehört, dass dort sonntags die Erwachsenen gegen kleines Entgelt auch Fußball geschaut haben. Dann wurde auch Bier verkauft – wohl ohne eine Konzession. Dies führte dazu, dass dem Besitzer alle seine „Veranstaltungen“ polizeilich verboten wurden. Wir waren sehr traurig.
Wann dann die Hütten abgerissen wurden, erinnere ich nicht mehr, obwohl ich noch – nachher mit meiner eigenen Familie – lange im Kraepelinweg gelebt habe.
Hamburg, 2015 Wolfgang Wulff
Barmbek Erinnerungen von Günter Sohnemann. Bananen, ein Tretroller und vier Barmbeker Brieten.Erinnerungen an die frühen 1950er Jahre - von Günter Sohnemann
Ein Tretroller zum Geburtstag
Es war in der Nachkriegszeit. Die Währungsreform, die DM war auch nach Hamburg gekommen. Genauer gesagt nach Barmbek-Süd, in die „Wilhelm Adolph Passsage“. Wir schreiben das Jahr 1952: Abbruch von Ruinen, Nissenhütten und auch schon Neubauten prägen den Neuanfang nach dem Krieg. Ich war 10 Jahre alt, mein Freund Manfred hatte einen Tretroller mit Ballonreifen und Gepäckträger zum Geburtstag bekommen. Manfred war großzügig, wir, seine Freunde durften alle mal auf seinem Tretroller fahren. Einmal die Straße rauf und wieder runter. Wir lobten diesen Roller, Mensch Manfred, Glückwunsch zum Geburtstag und diesem Roller!

Das war genau richtig. Für unseren Freund Manfred war das Lob, dass wir ihm und seinen Roller zollten, wohltuende Schmeicheleien, von denen er nicht genug kriegen konnte. Wir lobten die Stabilität und Qualität des Rollers. „Darauf kann man bestimmt zu zweit fahren!“, sagten wir ihm. Wir erklärten Manfred wie das gehen soll. Also, ich stelle meinen linken Fuß auf die Hälfte des Trittbrettes, fasse den Lenker mit den Händen ganz außen an und du stellst deinen rechten Fuß auf das Trittbrett neben meinen linken Fuß. Deine Hände fassen den Lenker links und rechts neben meinen Händen an. Dann treten wir gemeinsam, du und ich auf Kommando, ok?
Das ging ganz toll. Wir wechselten links und rechts. Nun waren wir schneller und ausdauernder. Das ganze war schön und gut, aber wir waren vier Freunde. Schade, dass zwei immer warten mussten bis die anderen zwei immer warten mussten, bis die anderen zwei wieder da wieder kamen. Einmal um den Häuserblock war abgemacht. Aber bald wurden es zwei Häuserblocks und so weiter. Das Warten auf den Roller dauerte immer länger. Da kam ich auf die Idee, eigentlich könnte man ja zu dritt, nein zu viert auf dem Roller fahren. Da kamen sie um die Ecke gerollert, strahlende Gesichter. Stolz und begeistert berichteten sie, wie sie im Barmbeker Nachbarstadtteil Winterhude bis in die Karlstraße und an die Aussenalster gefahren waren. Die beiden aufgeregten Erzähler Manfred und Kurt schauten ganz irritiert, als Erik und ich den beiden Vorwürfe machten, uns so lange warten zu lassen. Wir wollten ja schließlich auch mal Roller fahren. Uns fehlte jedwede Einsicht, dass ja Manfred Eigentümer und Besitzer des Tretrollers ist. Ich machte ihm klar, dass er sich seinen Tretroller sonst wo hin schieben kann. Dann sagte ich ihm, mit der überzeugenden Logik eines Zehnjährigen, mein Fußball macht doch auch nur Spaß , wenn wir alle zusammen spielen. Er soll seinen Roller nehmen und alleine damit spielen. „Schuftig“; dachte ich, das wird eine einsame Nummer. Wo Manfred ganz offensichtlich uns brauchte um anzugeben. Ein Angeber braucht ja Zuhörer und wenn wir drohten ohne ihn zu spielen? Mit dem Argument gruben wir ihm das Wasser ab. Verlegen sagte Manfred: „Nun könnt ihr doch fahren.“ „Ja, ja“, sagte ich: Und wenn wir dann zu lange weg sind, machst du ein lautes Geschrei um deinen Roller.“ So zankten wir noch eine Weile. Dann sagte ich: „ Du Manfred ich hätte da eine Idee. Ich weiß wie wir alle vier auf dem Roller fahren können.“ „Kommt überhaupt nicht in die Tüte“, sagte Manfred;“ nicht mit meinem Roller!“ Erik und Kurt wurden neugierig; „Wie denkst du dir das, erzähl es uns!“ So nett gebeten, ließ ich mich nun herab, meine Idee und mein Vorhaben in den schönsten Farben und der Leichtigkeit, mit der es zu machen ist zu erzählen. Also, ich denke, Kurt setzt sich auf das Trittbrett mit den Beinen nach vorne. Mit den Händen hält er sich an der Lenkerstange fest. Seine Beine legt er über Kreuz um die Lenkerstange auf dem Schutzblech vom Vorderrad ab. Nun stellen Erik und Manfred sich wie gehabt mit den Füßen je zur Hälfte auf das Trittbrett und die Füße ein bisschen unter den Po von Kurt. Die Arme über Kreuz mit den Händen am Lenker festhalten. „Und du, wie willst du mitkommen?“ „Ja“, sagte ich; „ ich setze mich auf den Gepäckträger, für meine Füße ist noch ein bisschen Platz hinter euch, auf dem Trittbrett. Festhalten werde ich mich an euren Hosenträgern und Gürtel.“ „Ausprobieren, Ausprobieren“, schrien Erik und Kurt begeistert. Manfreds Gejammer: „Mein Roller, mein Roller wird durchbrechen“, stoppte unsere Euphorie. „Dein Roller durchbrechen; du spinnst ja, der ist so stabil. Schau dir diese Eisenrohre an, wie stabil die verschweißt sind. Der Roller bricht niemals zusammen, der trägt uns vier mit Leichtigkeit.“

„Der Jürgen Bruns hat doch auch so ein Roller“, sagte Kurt; „weißt Du, was ich gesehen habe, seine Mutter holt immer Kohlen von Schiller und Brooks. Einen Zentner Brikett stellt sie auf das Trittbrett des Rollers. Und wenn es da oben an der Straße leicht bergab geht, dann stellt sie sich auch noch auf den Roller und rollert die Straße runter.“ Das war zwar nur die halbe Wahrheit. Denn der Tretroller von Jürgen Bruns hatte seitdem einen Knick im Rahmen und das Trittbrett schleifte dann und wann auf dem Straßenpflaster. Auch der Lenker hatte nun eine neue Form angenommen. Aber all das musste Manfred nicht wissen. Also lobten wir wieder seinen Roller, seine Stabilität, seine Qualität. Seine Bedenken wurden von uns zerstreut. Unsere Zusage reichte ihm, wenn der Roller zusammenbricht, müssten wir ihn bezahlen. „Aber natürlich!“, sagten wir alle. Gedacht habe ich aber wovon? Meine Mutter und wir vier Kinder, wir waren arm. Die erste Probefahrt verlief sofort so gut, als ob wir das immer schon so gemacht hätten. So, nun musste keiner mehr auf die anderen warten. Es war toll, als ich zum ersten Mal unsere Straße Wilhelm Adolph Passage mit meinen Freunden auf dem Roller verließ.

Raus aus Barmbek
Die Fahrt ging über die Straßen Beim alten Schützenhof über die Bachstraße in die Heinrich-Hertz Straße an Trümmerfelder und Ruinen vorbei. Am gewaltigen Wasserturm im Winterhuder Weg, Ecke Heinrich Hertz Straße machten wir staunend eine kleine Pause. Diesen riesigen Backsteinturm hatten wir immer von Weitem in der Trümmer- und Ruinenwüste gesehen. Nun standen wir am Fuße dieses Wasserturms, staunten über dieses gewaltige und fast unbeschädigte Bauwerk.
Unbeschädigte Häuser aus dem Krieg gab es nicht all zu viele in Barmbek. Hier auf der Uhlenhorst sah es schon besser aus. Am Hofweg gingen wir in ein Teppenhaus, die Tür stand auf. Für unsere Kinderaugen, die nur Trümmerwohnungen und Nissenhütten gesehen hatten, was das hier ein Palast. Bunte Fliesen, reicher Stuck an der Decke und zwei große Spiegel im Flur des Hauses, die genau gegenüber an den Flurwänden waren. Wenn man hineinschaute, sah man seinen Hinterkopf und ganz viele davon im Spiegel bis in die Unendlichkeit, meinten wir. Unsere Bewunderung war wohl zu laut und wir wurden von einem Bewohner auf die Straße gejagt.
Weiter ging die Fahrt durch die Karlstraße an die Außenalster. Welch ein schöner Anblick. Mein erster See, den ich sah. Nun sahen wir alle das, was wir von den Älteren in der Straße gehört hatten. Fantastisch, es war schön, es war super schön. Begeistert rollerten wir zurück in unsere kleine Welt der Wilhelm Adolph Passage und erzählten lautstark den Kindern, die noch nie aus der Straße weg waren, unsere Eindrücke. In der Passage gab es zu der Zeit sehr viele Kinder, die mit ihren Eltern durch die Folgen des Krieges nach Hamburg geflohen waren. Die waren in Hamburg noch nicht weit rumgekommen. Wir fühlten uns als Entdecker, waren wir doch auch, oder? Dieser Ausflug war schön und unvergessen. Auf dem Roller ging es wunderbar, denn wir wechselten uns ab, im Treten oder Sitzen. Jeder von uns konnte jeden Platz einnehmen. Wir waren ein Rollerteam geworden. Bald war die nähere Umgebung erforscht, dann ging es in eine andere Himmelrichtung. Wir wollten nun einmal Hamm kennenlernen.
Unsere Neugier auf andere Stadtteile haben wir von den älteren Jungen in unserer Straße, die schon auf Fahrrädern im zerbombten Hamburg unterwegs waren, um aus den Ruinen Buntmetall zu bergen. Kupfer aus altem ausgeglühten Bergmannsrohr, das sind die Stromkabel in den Ruinen, das war eine gute Geldquelle. Die Schrotthändler zahlten gute Kilopreise. Auch wir wollten unser Glück versuchen. Die Erzählungen der älteren Jungen kam der Dichtung näher als der Wahrheit. Wir fanden kein Kupferkabel in den Ruinen, das hatten schon längst die Bewohner der Keller in den Ruinen eingesammelt. Aber das wussten wir noch nicht, als wir vier uns auf den Weg mit dem Roller machten. Wir fuhren von der Wilhelm Adolph Passage über die Hamburger Straße entlang dann ging es die Wagnerstaße bis zur Wandsbeker Chaussee in die Ritterstraße bis zur Sahling. Das fanden wir lustig, denn Manfred hieß mit Nachnamen auch Sahling. Auch dieser Stadtteil war im Krieg schwer getroffen. In den Straßen standen Nissenhütten, in den Ruinen lebten und wohnten Menschen. Es gab wenige Häuser, die noch heile waren. Aber die Aufbauarbeiten waren schon überall zu sehen. Wir rollerten nun nicht mehr, wir schoben den Roller, um nach Beute in den Trümmern zu schauen. Aber wir entdeckten und fanden keine Kupferleitungen mehr.

Was esst ihr da?
Uns fiel aber auf, dass viele Kinder in den Trümmern Steine kloppten. Und am Straßenrand standen viele aufgestapelte geputzte Steine. An einem dieser Steinstapel standen drei Jungen und machten Pause. Sie aßen etwas gelbes, wir fragten sie: „ Was esst ihr den da?“ „Bananen!“ Wir hatten von Bananen gehört, aber noch nie gesehen, geschweige gegessen. „Mann, wo habt ihr die denn her?“, fragten wir die Jungs. „Aus dem Freihafen.“ Nun erzählten sie stolz, wie man an die Bananen kommt. Bereitwillig und auch etwas stolz, dass sie schon pfiffig genug waren, sich wie selbstverständlich Bananen aus dem Freihafen zu holen. Wir müssen wohl sehr fragend aus der Wäsche geschaut haben. Nun klärten sie uns auf: Im Freihafen kämen so viele Dampfer mit Bananen aus Südamerika und Teneriffa an. Und dass die Bananen grün sind, wenn sie in Hamburg ankommen. Zwischen den grünen Bananen sind oft gelbe Bananen, also reife Bananen und die müssen da raus, sonst werden die grünen auch noch zu schnell reif. Und beim Transport durch Deutschland würden sie alle verfault beim Obsthändler ankommen. So, und diese gelben, schon reifen Bananen kann man sich vom Bananenschuppen holen. Wir ließen uns den Weg beschreiben. „Ganz einfach immer der Straßenbahn Linie fünfzehn folgen über die Elbbrücken bis zur Veddel, dann am Zoll vorbei in den Segelschiffshafen.“ Das reichte uns, diesen Tag rollerten wir zurück nach Barmbek. Auf dem Roller machten wir schon lautstark Pläne, in den Freihafen zu rollern, um uns jede Menge Bananen zu holen. Unsere Familien sollten Bananen kriegen und so viel essen, bis es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Wir lachten uns schimmelig und vergaßen fast das Treten. Schweigend bogen wir in unsere Passage ein. Wir hatten ein Geheimnis, wir hatten einen Plan. Es waren schöne Sommertage und zu unserem großen Glück auch noch Schulferien. Wenn Manfred mit seinem Roller nicht da war, weil er mit seinen Eltern irgendeinen Besuch bei einer alten Tante machen musste, dann spielten wir in den Trümmern der Ruinen. Manchmal gruben wir in den Trümmern nach etwas Brauchbarem. Im Schutt und Geröll war so manches Stück Porzellan eingebacken. Ich fand beim Graben in diesem Schutt so manches brauchbares Porzellan. Das waren Eierbecher, Teller, Kaffeekannen und sogar eine große Zuckerdose aus Porzellan. Diese Porzellandose habe ich verschenkt an meine Tante Martha. Dort hat sie gute Dienste getan. Oft stand sie auf dem Tisch und wir Kinder haben uns daraus Zucker aufs Magarinenbrot gestreut. Köstliche Erinnerungen werden wach. All das hatte seinen Reiz verloren gegenüber unserem Plan, im Freihafen vom Bananenschuppen Bananen zu holen.

Mit dem Roller in den Freihafen
Wir wussten, so einfach wird das nicht. Die erste Hürde ist es, in den Freihafen zu kommen, am Zoll vorbei. Genau wo die Amerikastraße und das Amerikahöft ist, da sollte der Bananenschuppen sein. Es war eine uns unbekannte Gegend. Es war spannend, als wir eines Tages los fuhren. Wir hatten niemandem etwas davon erzählt. Wir hatten gelernt aus unseren Erfahrungen mit der Kupferdrahtsuche in Hamm. Wenn man alles erzählt, dann gehen wieder zu viele Kinder los und dann gibt es vielleicht keine Bananen mehr. Wir wollten in unserer Straße die Ersten sein. Nach dem Frühstück trafen wir vier uns. Unser Kunststück zu vier auf einem Tretroller zu fahren, war für unsere Eltern schon ein gewohnter Anblick. Wir sagten Ihnen, wir fahren ein bisschen rum und wollten nicht zum Mittagessen zurück sein. In den Ferien hatte meine Mutter dafür Verständnis und die Mütter meiner Freunde auch. Nun ging es auf große Fahrt Richtung Mundsburg und dann der Straßenbahnlinie Nummer fünfzehn nach. Über Berliner Tor, den großen Elbbrücken bis zur Veddel. Dort fragten wir gleichaltrige Kinder, wie wir zum Bananenschuppen gelangen könnten. Die erzählten uns, dass wir nicht alle zusammen an den Zollbeamten vorbeigehen sollten. Zu zweit sollten wir gehen und wenn wir gefragt werden, „Wohin?“, sollten wir sagen „Meine Tante wohnt in der Amerikastraße, wir sind da auf Besuch.“ So machten wir es. Im Abstand von fünf Minuten gingen wir am Zollbeamten vorbei. Wir wurden gar nicht beachtet, mein Herz bubberte und es gab keinen Grund Angst zu haben. Wir trafen uns circa hundert Meter hinter dem Zoll. Außer Sichtweite vom Zoll nahmen wir unsere Plätze auf dem Tretroller wieder ein. Mann – waren wir glücklich. Wir waren im Freihafen.
In uns sang das Lied der Cowboys yiipiee yaa yaa yiepiee yaa yaa. Was waren wir doch für tolle Kerle, wir zehnjährigen Barmbeker Brieten. Nun sahen wir, was der Krieg im Freihafen alles zerstört hatte: Kaimauern mit großen Bombentrichtern, abgebrannte Ladeschuppen, von denen nur die Verwaltungsgebäude stehen geblieben waren. In einigen wohnten Familien. Ich wusste da noch nicht, dass ich ganz dicht bei Onkel Fiete und Tante Anna in der Amerikastraße vorbei rollerte. Die waren auch ausgebombt und hatten in der Amerikastraße in so einem Verwaltungsgebäude am Ende eines ausgebrannten Schuppens eine Notwohnung bekommen. Auf diesen abgebrannten Schuppen wuchsen schon Büsche und Bäume. Auf den Eisenbahnschienen standen uralte Waggons. Das sahen wir alles, als wir Kinder diese unglaublich lange Amerikastraße entlang rollerten, immer weiter zum Amerikahöft. Wir sahen Schiffmasten, Schornsteine von qualmenden Dampfern, Kräne, die sich drehten und Ladung aus dem Schiffsbauch an Land setzten. Aber keine Bananen, wir rollerten weiter. Endlich ein großer Schuppen und ein schneeweißes Schiff.
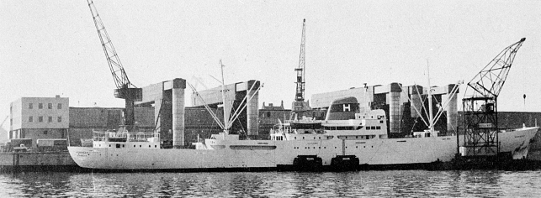
Im Bananenschuppen
Wir hatten gehört, die Bananendampfer sind alle weiß angestrichen. Wir sahen viele Hafenarbeiter, die grüne Bananenstauden auf Karren in die Schuppen brachten. Alle liefen geschäftig durcheinander, alle arbeiteten. Nur zwei Männer mit einer Schirmmütze, einer mit einem dicken Goldrand und einer mit einem dünnen Goldrand, standen nur rum, sahen nur zu. Hin und wieder gab der eine oder andere Anweisungen an die Arbeiter. Die hatten wohl das Sagen, da trauten wir uns nicht hin. Also zogen wir uns erstmal zurück. Nun umrundeten wir den Bananenschuppen, wir hatten nur einen Gedanken, wie kommen wir da rein. Von der Straße kam auf einmal unsere Chance. Ein LKW verließ die Ladeluke vom Schuppen und in der Luke stand ein Arbeiter, der sah uns an:“Na, was macht ihr denn hier?“ Wir sagten ihm: „Wir wollen ein paar gelbe Bananen!“ „So, dann kommt mal mit“, forderte er uns auf. Wie die Blitze waren wir bei diesem Arbeiter in der Ladeluke vom Schuppen. Jetzt konnten wir gut in den Bananenschuppen sehen. Mann, war der groß, ich glaube zwei Fußballfelder reichen nicht, um die Größe zu beschreiben. Eine riesige Halle, in der Eisenbahnwaggons auf Eisenbahnschienen wie in einem Bahnhof eingefahren waren. An jedem Waggon waren Arbeiter damit beschäftigt, Bananen einzuladen. Es herrschte ein emsiges Treiben. Die Arbeiter sortierten an Fließbändern die Bananenstauden und schnitten die gelben, reifen Bananen ab.
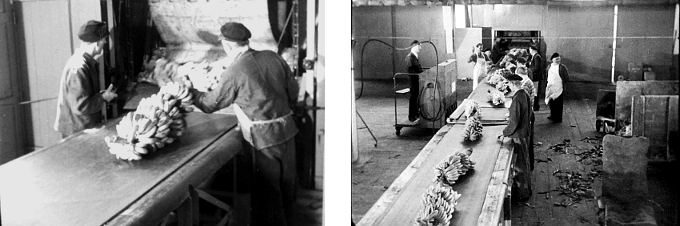
Mit Schwung flogen die reifen Bananen in eine stählerne Abfallkiste, die schon so voll war, dass die Bananen wieder auf den Hallenboden fielen. Dort wurden sie von den Elektrokarren, die mit Bananen beladen in der halle hin und her fuhren, breit gefahren. Schade um diese schönen Bananen, dachten wir. Der Arbeiter sah unser Staunen: „ Das muss sein!“ sagte er uns, „ Die gelben Bananen können keine Reise im Land per Eisenbahn antreten. Dann haben die Kaufleute großen Schaden und Verlust. Also weg damit.“ Aber wir vier waren an diesen gelben Bananen sehr interessiert. Bei uns brauchen sie keine Reise durch das Land machen. Nur eine kurze durch unseren Bauch und nach Barmbek, dachte ich. Uns lief das Wasser im Munde zusammen. Der Arbeiter, der uns in den Bananenschuppen hineingelassen hatte, stand neben uns. Lachend zeigte er auf die gelben Bananen. „Ihr wollt doch Bananen, nehmt soviel Hände wie ihr wollt.“ Was sollten wir nehmen? Wir verstanden nur noch Bahnhof. „Hände, Jungs“ , sagte er und klärte uns auf. Hände das sind die zusammengewachsenen Bananen am Stamm der Bananenstaude. Wenn sie gelb waren, wurden sie von der Bananenstaude abgeschnitten und weggeworfen, das waren denn mal eben ca.10 Bananen auf einmal. Mit einem Handgriff hatte jeder von uns zehn Bananen gegriffen. „Nehmt mehr!“, forderte uns der Mann auf; „Aber lasst euch nicht vom Schuppen-Vizen schnappen. Der mag nicht, dass hier Kinder herumlungern, wo so viele Karren hin und her rollen. Karren geschoben von Heerscharen von Hafenarbeitern, wie leicht kann es in diesem Gewühl zu einem Unfall kommen. Schnell packte sich jeder zwei Hände Bananen und nichts wie weg zu unserem Tretroller.

Zurück nach Barmbek
Da stand unser guter Tretroller und wir wie begossene Pudel davor. Wie sollten wir denn fahren mit all den „Händen“ Bananen in unseren Händen. Es war doch Sommer und sehr warm, wir hatten nur Turnhosen und ein Unterhemd und Sandalen an. An Beutel oder gar Rucksack hatte keiner von uns gedacht. Ich machte den Vorschlag: einer von uns schiebt den Roller und wir tragen seine Bananen mit. Ungefähr dreihundert Meter von hier hatte ich einen in Kriegstagen abgebrannten Schuppen gesehen. Der war schon ganz verwildert. Birken und Büsche hatten sich dort schon angesiedelt. Da gab es Schatten, dort werden wir eine Pause machen und Bananen „satt“ essen. Es war ein guter schattiger Platz , den wir fanden. Alte schrottreife Eisenbahnwaggons standen auf den Schienen vor den Resten dieses abgebrannten Schuppens, auch die mussten wir inspizieren. Die Waggons hatten alle ein „Bremser-Häuschen“. Die Bremskurbel war kinderleicht zu bedienen, es machte wirklich Spaß daran rumzukurbeln. Auf einmal merkten wir , dass die Waggons „gaaanz laangsam“ in Bewegung kamen. Geistesgegenwärtig drehten wir die Bremskurbel wieder zurück und die alten Güterwaggons standen wieder. Da hatten wir genug von diesem Abenteuer. Schnell liefen wir wieder zu unserem Roller und den Bananen. Wir hatten schon jeder eine Banane in den Händen beim Inspizieren der alten Güterwaggons und ließen sie uns schmecken. Aber nun setzten wir uns auf den Boden im Schatten einer Birke. Jeder von uns hatte so zwanzig Bananen vor sich liegen und nun aßen wir einige davon mit Genuss. Wir beteuerten uns gegenseitig, so etwas tolles noch nie gegessen zu haben. Beinahe gierig stopften wir sie in uns hinein. Festschmaus auf der Ruine eines alten ausgebrannten, ausgebombten Kaischuppens. Aber bei mir war nach der dritten Banane Schluss. Ich konnte nicht mehr. Nur der kleinste von uns, Kurt, der schaffte eine vierte Banane. Damals habe ich sehr gestaunt. Heute glaube ich, Kurt hat sich schlichtweg verzählt. Wir hatten einen guten versteckten Platz. Müdigkeit breitete sich aus und wir streckten uns im Schatten dieser Büsche und jungen Bäumen wohlig aus, dösten und schliefen in dieser sommerlichen Nachmittagssonne ein. Es war alles so friedlich, so ruhig. Wir waren so satt, wie lange nicht mehr. Der süße Geschmack auf der Zunge und das Bewusstsein, ein unvergessliches Abenteuer erlebt zu haben, gab uns das Gefühl von inniger Zufriedenheit. Volle Bäuche, erschöpft vom neu entdeckten, schliefen wir vier doch tatsächlich ein, bis wir wieder etwas fröstelnd wach wurden. Die Sonne hatte ihre Mittagskraft verloren. Nun hatten wir es aber eilig, nach Hause zu kommen. Wie nun aber die Bananen transportieren? Wir hatten doch nur Turnhose und Unterhemd an. Kurt, unser Kleinster und Jüngster, hatte in dem Waggon ein etwas dickeres und längeres Band gesehen. Er holte es. Mit einer Glasscherbe, von einem Fenster, teilten wir uns diesen Strick. Es war lang genug, für jeden von uns, daraus einen Strickgürtel zu machen. Jeder machte sich einen stramm sitzenden Gürtel über das Unterhemd aus diesem Strick. Die Bananenhände steckten wir von oben unter unsere Unterhemden. Die Bananen beulten unser Unterhemd gewaltig aus, jeder konnte sehen, was wir da unter unseren Unterhemden transportierten. So fuhren wir vier auf unseren Ballontretroller los. Etwas hinderlich waren die Bananen unter den Unterhemd und auf der Haut. Aber wir hielten öfters an, um den Sitz der Bananen zu verändern und zu sichern. So kamen wir am Zoll an. Ein älterer Zollbeamter stellte sich uns in den Weg: „Halt, Halt, habt ihr was zu verzollen?“, fragte er uns. Verzollen? Wir verstanden nicht, was er meinte, aber Angst hatten wir nun doch, dass er unsere Bananen haben wollte. Wir fragten ihn, was verzollen bedeutet? Dann klärte er uns auf, dass man nichts ohne Verzollen aus dem Freihafen bringen darf. Und das Verzollen kostet Geld. Und wer nicht verzollt und erwischt wird, ist ein Schmuggler. Und Schmuggler werden bestraft und kommen ins Gefängnis. Unser Herz rutschte uns in die Turnhose vor Schreck, wir sahen unsere Bananen schon verloren, da kam ein jüngerer Zollbeamter auf den älteren Kollegen zu. „Mensch Kuddel, de Jungs hebt doch nur gele Bananen, morgen sind die schlecht und vergammelt. Das ist doch nur Fegsel“, meinte der junge Zollbeamte mit einem Augenzwinkern zu dem altgedienten Zollbeamten. Der sagte mit hochgezogenen Augenbrauen zu uns: „So, so Fegsel habt ihr da, naja, dann will ich mal heute ein Auge zudrücken. Ab mit euch Brieten, ich will euch nicht noch mal erwischen!“ Lachend gab er uns den Weg frei. Vier Kinderherzen, eben noch zitternd, bubbernd, jubelten innerlich auf und ungeahnte Kräfte brachten uns von der Veddel mit dem Roller nach Barmbek, in die Wilhelm Adolph Passage.

Die Beute wird verteilt
Dort angekommen mit unserer Beute, unseren anderen Spielkameraden stolz die Bananen zeigend, aber nicht eine abgebend, habe ich meiner Mutter siebzehn Bananen auf den Küchentisch gelegt. Wir waren sechs Personen im Haushalt, die sich alle über diese Südfrüchte freuten. Da wurde die Klingel an der Tür gedreht. Unsere Nachbarin Frau Holze stand vor der Tür: „ Frau Sohnemann, ich habe gehört, Günter hat Bananen aus dem Freihafen geholt. Darf ich ihn fragen, wo und wie er das gemacht hat?“ Sie durfte und ich erzählte alles genau, was wir heute gemacht hatten. Nur vom Zoll erzählte ich nichts. Das klang ja alles sehr einfach. „Morgen schicke ich meinen Mann in den Feihafen mit dem Fahrrad zum Bananen holen.“ Dabei schaute sie auf den Küchentisch, wo meine, unsere Bananen lagen. „ Ach, Frau Sohnemann, können sie mir heute ein paar Bananen ausleihen? Sie bekommen sie morgen wieder, von den Bananen, die mein Mann morgen mit dem Fahrrad aus dem Freihafen holt.“ Meine Mutter zählte die Bananen durch und gab Frau Holze fünf Bananen. So hatte jeder von uns zwei Bananen zum Verzehr. Was ich so auch in Ordnung fand. Die Holzes waren fünf Personen. Für die Kinder waren es die ersten Bananen in ihrem Leben und nach dem Krieg. Was noch anzumerken ist: Am nächsten Tag war das Fahrrad von Herrn Holze kaputt, am nächsten Tag darauf auch. Dann war alles wieder heile, aber er hatte keine Zeit, in den Freihafen zu fahren, er hatte Arbeit bekommen. Und in den Geschäften bei den Grünhöckern waren sie jetzt regelmäßig im Angebot, die Bananen. Mir bleibt nur noch zu berichten, dass der Tretroller von Manfred bald auch so ausgesehen hat wie der von Jürgen Bruns, dessen Mutter mit dem Roller öfters Brikett vom Kohlenhöcker geholt hatte. Aber an Weihnachten war für uns alle ein Ballontretroller unter dem Weihnachtsbaum. Unsere Trittbretter waren alle gerade. Nur das von Manfred zeigte nach unten. Als er über dieses Aussehen jammerte, haben wir ihm erzählt: „Das sieht doch viel besser aus, als unsere gerade Bretter.“ Ich weiß bis heute nicht, ob er uns das abgenommen hat. Aber ein dufter Spielkamerad war Manfred allemal.
Hamburg, 2010 Günter Sohnemann
